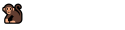Zu den ideologischen Wurzeln des akademischen Antiisraelismus
In dem besonders bei Mittelstufen-Schülern berüchtigten Theaterstück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch tritt neben den im Titel genannten eine Figur namens „Dr.phil.“ auf, der den Brandstiftern nahesteht, aber auf ihre pure Lust am Zündeln herabschaut. Für ihn ist das Brandstiften ein ernsthafter, ideologischer Auftrag. Dennoch deckt er die Brandstifter und liefert ihnen eine rationale Erklärung für ihr Tun. Am Ende des Stücks lehnt er zwar den Akt des unideologischen Verbrechens ab, aber die Lunte ist zu diesem Zeitpunkt bereits gelegt. Womit wir bei den antiisraelischen und antisemitischen Stimmen in der deutschen Hochschullandschaft wären.
Einen vorläufigen Höhepunkt fanden diese mit den Twitter-„likes“ der Präsidentin der TU Berlin für Gleichsetzungen von Netanjahu mit den Nazis, sowie einem geplanten Vortrag von Hamas-Sympathisanten an der Universität Heidelberg. Die Leitung der Universität konnte sich auch im Nachgang nicht dazu durchringen, diesen eindeutig antisemitischen Vortrag abzusagen, sondern beließ es bei einer Verschiebung mit weiterer Diskussion über die Teilnehmer. Der Eindruck einer implizit zustimmenden Appeasement-Maßnahme bleibt bei diesem Vorgehen bestehen.
Etwa 400 Berliner sowie 1000 weitere deutsche Hochschullehrer verteidigten zuvor die „Freiheit“, das gesamte Arsenal eliminatorischen Israelhasses auf den Geländen deutscher Universitäten aufzufahren: Die allgegenwärtigen roten Hände, Symbol für Legitimierung von Lynchmorden gegen Juden, das anbringen roter Dreiecke, eine Mischung aus Nazi- und Killerspielsymbolik, antisemitische Flyer sowie Sprechchöre darüber, wie Israel über den 7. Oktober lüge oder dass Palästina bitte vom Fluss bis ans Meer reichen solle, eine Abwandlung der bereits vor der Staatsgründung existierenden Doktrin arabischer Führer, die Juden ins Meer treiben zu wollen. Es war offensichtlich, dass der Hass auf das als illegitim angesehene zionistische Gebilde mindestens gleichwertige Triebfeder dieses Protestes war neben der Solidarität mit den Menschen in Gaza.
Als die BILD-Zeitung sich die Freiheit nahm, einige der Namen der Unterstützenden Hochschulangehörigen abzudrucken mit der Einordnung, diese würden die „UniversiTÄTER“ (eine BILD-typische rhetorische Figur) unterstützen, verurteilte dies die altehrwürdige Deutsche Gesellschaft für Soziologie im Namen der „Wissenschafts“- und in Verachtung der Pressefreiheit. Einzig namentlich Unterzeichnende war hier die DGS-Vorsitzende und Gender-Studies Professorin Paula-Irene Villa Braslavsky, für die es „scheint, dass bestimmte Disziplinen (so auch die Soziologie) und Forschungsfelder (etwa die Postcolonial Studies) als angeblich per se politisch und antisemitisch ins Visier genommen werden.“
Dass sich die Soziologie oder gar die postcolonial studies auch nur in irgendeiner Weise unpolitisch betreiben ließen, würden ihre einflussreichsten Vertreter wohl mit Nachdruck bestreiten. Aber Frau Villas Einlassung deutet auch auf einen Punkt hin, der in der bisherigen Diskussion unterbeleuchtet blieb: Eine vom Historiker Michael Wolfssohn durchgeführte „quantitative Auswertung“ ergab, dass von „Hochschullehrern, die sich (…) mit den antijüdischen Demonstranten solidarisierten, (…) ein deutliches Übergewicht an Islamwissenschaftlern, Arabisten, Migrationsforschern, Philosophen, Soziologen, Ethnologen, Historikern und Politikwissenschaftlern“ bestehe.
Selbst Meron Mendel und Saba Nur-Chema, denen man keine weitgehende Ablehnung der akademischen Israelkritik nachsagen kann, merkten in ihrer FAZ-Kolumne an, dass jene Klientel sich normalerweise „schnell zu Wort [meldeten], wenn rassistische, sexistische und queerfeindliche Meinungen in der Öffentlichkeit oder auf dem Campus geäußert werden“ (und schnell nach der Eingriff staatlicher Kontrollmaßnahmen rufen, möchte man hinzufügen), wohingegen „ihre Sensoren für Antisemitismus zumindest auf Stand-by gestellt“ seien. Wird eine so offensichtliche Doppelmoral von einer größeren Gruppe zumindest akademisch gut ausgebildeter Personen geteilt stellt sich die Frage, ob dies vielleicht an einer weltanschulichen Voreingenommenheit liegt, womöglich einem Bestandteil jener Ausbildung. Konkret wären dabei die ideologischen Wurzeln auszumachen, welche die Ablehnung gegenüber dem einzigen jüdischen Staat aus den marxistisch gefärbten 60er und 70er Jahren in die identitätspolitisch inspirierte Gegenwart hinüberretteten.
Es könnte hier erhellend sein, sich die deutlichen Parallelen zur letzten großen Besetzung an einer deutschen Universität zu betrachten. Nach der Schließung des soziologischen Seminars der Universität Frankfurt durch die Direktoren Adorno und Habermas dringen am 31. Januar 1969 Studenten in das Institut für Sozialforschung (IfS) ein und verweigern jeden Dialog. Adorno ruft daraufhin widerwillig die Polizei und lässt das Institut räumen. Dies ist der Schlusspunkt in der wachsenden Entfremdung der Studenten von ihren ehemaligen Idolen Adorno und Horkheimer, die sich nicht zuletzt über das Existenzrecht des jüdischen Staates entzweien.
Das Israelbild der deutschen Linken wandelte sich 1967 praktisch komplett innerhalb der Dauer des Sechstagekrieges. Wurde Israel zuvor als Arche der Überlebenden, zumal eine sozialistisch eingestellte, angesehen, so war schon während des Krieges »Dem unterstützungswürdigen David (…) ein verwerflicher Goliath entwachsen«, wie es der damals 23-jährige Student und Vorsitzender des BJSD Dan Diner formulierte. Die linken Studenten im Westen Deutschlands brauchten für ihre Verdammung der „zionistisch-faschistischen Kolonisten“ keine Siedlungspläne im Westjordanland abwarten, genau wie heute die Genozid-Anklage bereits vor einer militärischen Antwort Israels auf den 7.10. erhoben wurde. Es reichte, dass Juden für den akademischen Nachwuchs nicht mehr die Rolle des mitleidsbedüftigen Opfers ausfüllen konnten. Der Wechsel der Sympathie hin zu den Palästinensern bewegte sich auf dem Reflexionsniveau eines Fußballfans, dem ein ehemaliges Underdog-Team zu erfolgreich geworden war.
Adorno und Horkheimer standen dem Staat Israel, wie im Grunde allem Anderen auch, mit einer kritischen Distanz gegenüber, jedoch nicht ohne Sympathie und der Überzeugung von seiner Notwendigkeit. Vor allem waren sie schockiert vom primitiven Israelhass der Studenten. Als der israelische Botschafter am 9. Juni 1969 an der Frankfurter Universität über 2 Stunden lang niedergebrüllt wurde, schrieb Adorno an seinen langjährigen IfS-Mitarbeiter Herbert Marcuse: »Du müsstest nur einmal in die manisch erstarrten Augen derer sehen, die, womöglich unter Berufung auf uns selbst, ihre Wut gegen uns kehren.« Aber der Adressat war schon länger eher der Position der Studenten zugeneigt. Bereits als Antwort auf die Erklärungsversuche Adornos zur Räumung seines Instituts forderte Marcuse von ihm „die theoretische Courage, die Gewalt der Befreiung nicht mit der Gewalt der Unterdrückung zu identifizieren“.
Zu diesem Zeitpunkt war der Philosoph und Soziologe Marcuse bereits zum neuen Fixstern der Studentenbewegung sowohl in den USA als auch in Deutschland geworden und hatte darin seine beiden Frankfurter Kollegen abgelöst. Anders als diese hatte er nach Shoa und Stalinismus keineswegs die Hoffnung auf ein durch Revolution zu errichtendes sozialistisches Paradies aufgegeben, ganz im Gegenteil.
Er sah die Studentenrevolte als "Katalysator für den Zerfall des Kapitalismus", die Rolle des Proletariats in der Revolution sollten nach seiner „Randgruppenstrategie“ benachteiligte Gruppen einnehmen. Für den Umbau der Gesellschaft hin zu einem sozialistischen Paradies befand er eine zumindest übergangsweise Diktatur mit einem Verbot unliebsamer Meinungen und Presse für notwendig. Von seinem Lehrstuhl in Bekeley aus erschien ihm die immer noch entrechtete und benachteiligte afroamerikanische Bevölkerung als größte Randgruppe, die seine revolutionären Thesen in die Praxis umsetzen sollten. Aus diesem Grund unterhielt er gute Beziehungen zur Black-Power-Bewegung, aus der auch seine bekannteste Schülerin Angela Davis hervorging. Sie wurde zu einer weiteren Ikone der neuen Linken, nachdem sie für ihre Beteiligung an einen terroristischen Anschlag, der vier Todesopfer forderte, für einige Zeit in Untersuchungshaft kam. Nach diesem Erlebnis bezeichnete sie sich als Anwältin gegen staatliche Gewalt und für politische Gefangene und bereiste die realsozialistischen Länder, unter anderem auch die DDR. Als sie auf ihrer Station in der Sowjetunion gebeten wurde, ein Wort für die dort wegen ihrem Auswanderungswunsch inhaftierten Juden einzulegen antwortete sie, dass alle von ihnen „zionistische Faschisten und Feinde der Sowjetunion“ seien und „zurecht“ in Gefängnis saßen. Davis wurde mit dem Leninorden ausgezeichnet und daraufhin Professorin für „Women’s and Ethnic Studies“ an der Universität San Francisco, sowie emeritierte Professorin an der USC für „History of Consciousness and Feminist Studies“. Heute ist sie vor allem in der BDS-Bewegung aktiv und bestreitet das Existenzrecht Israels. Sie verbrachte auf Marcuses Anregung auch einige Zeit an der Universität Frankfurt, worauf einige Angehörige der Universität immer noch erkennbar stolz sind. So wurde 2013 am dort angesiedelten „Cornelia Goethe Centrum für Geschlechterforschung“, wo viele Unterstützer der Anti-Israel-Proteste ihre Anstellung haben, die „Angela Davis Gastprofessur für internationale Gender und Diversity Studies“ eingerichtet. Dies ist ihre zweite große Ehrung an einer deutschen Universität, nachdem ihr 1972 die Ehrendoktorwürde der intellektuellen Kaderschmiede der DDR, der Karl-Marx-Universität in Leipzig, verliehen wurde.
Davis und Marcuse sind heute sicherlich nicht mehr die prominentesten Referenzpunkte ihrer ideologischen Nachfolger. Sie können jedoch als Vorreiter eines Wandels der politischen Ausrichtung in den Geistes- und Sozialwissenschaften angesehen werden. Orientierten sich diese zuvor noch am traditionellen Marxismus, nach dem die kapitalistische Gesellschaft in Klassen eingeteilt war, die es abzuschaffen galt, wurden zuerst von ihnen die gesellschaftlichen Bruchlinien als vor allem entlang von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht verlaufend ausgemacht.
Anders als Klassen lassen sich diese jedoch nicht durch einen revolutionären Akt auflösen. Wegen der Mischung aus praktischer Unmöglichkeit und gesellschaftlichem Widerstand beschränken sich die politischen Ziele der heutigen akademisch beschäftigten Aktivisten darauf, eine partielle Befreiung durch ausgleichende Gerechtigkeit herbeizuführen, keiner Gleichstellung, wie es oft fälschlicherweise heißt, sondern einer Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse. Die Auswahl von Preisträgern, Stipendien- und Stelleninhabern nach Kriterien wie Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht, verbunden mit der Minimalvoraussetzung der ideologischen Zustimmung zu diesem Vorgehen, ist in diesem Teil der Universität sowie dem Kulturbetrieb, beides Bereiche in denen herausragende Leistungen nur schwer zu quantifizieren sind, inzwischen Usus.
An dieser Stelle wird der zentrale Bruch mit der prinzipiell universalistischen Ideologie des Marxismus deutlich, der es auf eine Einebnung aller Unterschiede zwischen den Menschen ankam. Die heute so deutlich wie möglich akzentuierten Kategorien von Gender, (Post-)Kolonialität, Intersektionalität oder Diversität weisen, zumindest in ihrer universitären Spielart, dem entgegen auf eine Hervorhebung von Unterschieden und damit eine partikularistische Ideologie hin. Die Ironie, sich dabei derselben biologischen Kategorien zur Unterscheidung von Menschen zu bedienen wird wie ihre Gegner von rechts, scheint an den betreffenden Akademikern vorbei zu gehen.
Die Festschreibung von biologisch markierten Opferidentitäten und die damit verbundene Möglichkeit, sich selbst als „white saviour“ zu inszenieren, als heroisch imaginierte Befreiungsfigur gegen die eigene Gruppe, bildet hier die einende Komponente, mit der sich Anhänger aus verschiedenen Generationen, sowohl jüdische als auch nichtjüdische, identifizieren können. Das Anliegen von Juden und der Kampf gegen Antisemitismus muss Anhängern dieser Denkrichtung fremd bleiben, weil sich jüdische Identitäten nicht in die von ihnen festgesetzten Kategorien pressen lassen. Vor allem in einem Konflikt zwischen Juden und eindeutig als Opfer kategorisierten Gruppen ist die Ausrichtung der Solidarität damit schon abseits jeder Berücksichtigung der Sachlage eindeutig verteilt.
Aber nur mit der Verfälschung der kritischen Theorie hin zu einer Identitätspolitik bliebe ein entscheidender Bestandteil der Ideologie noch ungenannt. Der Wandel von einer universalistischen hin zu einer partikularistischen Ideologie geht Hand in Hand mit einer Bewegung hin zu einer antimodernen, antihumanistischen Ausrichtung, einer Ablehnung von allem, was mit „dem Westen“ und seinem Wertekanon verbunden ist. Individualismus wird hier als nur eine der Chimären angesehen, die der Westen im Werkzeugkasten der Aufklärung mit sich führte, um die indigenen Völker der Welt zu unterwerfen. Dass nicht individuelle Erfahrungen, sondern nur die „Strukturen“ in die das Individuum hineingeboren wird bestimmen, wer in der Gesellschaft als Täter oder Opfer agiert, geht auf den (Post-)Strukturalismus der „french theory“ zurück, die mit den Namen Lévi-Strauss, Foucault oder Derrida verbunden ist. Lévi-Strauss steht als einflussreichster Anthropologe des 20. Jahrhunderts für die Ehrenrettung des Topos des „Edlen Wilden“, einem romantisch verklärten Bild des naturwüchsigen Eingeborenen, der vom Imperialisten ein westliches Korsett aus Vernunft, Wissenschaft, Fortschritt und Demokratie gezwungen werden soll. Vor allem durch den von Frankreich brutal geführten Algerienkrieg wurde diese Figur unter den widerständigen französischen Intellektuellen aus der Mottenkiste des Orientalismus geholt. Jaques Derrida, ein aus Algerien stammenden sephardischer Jude, kann als Wegbereiter der Tendenz gesehen werden, dass jegliche Maßstäbe einer kulturübergreifenden „Vernunft“ oder Wissenschaftlichkeit in den seinen Maximen folgenden Fächern wie den Gender Studies oder dem Postkolonialismus misstraut wird. Auch Recht und Unrecht werden somit zu kulturell relativen Begrifflichkeiten. In den 90er Jahren, als sich dieser theoriezweig in Frankreich selbst auf dem absteigenden Ast befand, erlebte er eine Blüte im von Kämpfen um Political Correctness aufgebrachten USA, und wurde von dort an Universitäten weltweit reimportiert. Wie die konsequente Anwendung des auf links-amerikanisch gedrehten Poststrukturalismus aussieht kann man an Aussagen ihres heute bekanntesten Aushängeschilds, der Gender- und Queer Studies Ikone Judith Butler erkennen, die beispielsweise zum Burkazwang der Taliban anmerkte, dass dieser „symbolisiert, dass eine Frau bescheiden und ihrer Familie verbunden ist; aber auch, dass sie nicht von der Massenkultur ausgebeutet wird und stolz auf ihre Familie und Gemeinschaft ist (…)“.
Vor dem beschriebenen Hintergrund wird deutlich, dass es sich nicht um eine politische Meinung einer ansonsten theoretisch unbescholtenen Wissenschaftlerin handelt, sondern dass diese Denkweise für ihre Denkrichtung einen zentralen Punkt darstellt. Butlers eindeutige Verteidigung und Solidarisierung mit der Hamas und der Hisbollah sind der theoretische Endpunkt der heute in fast allen Bereiche der Sozial- und Geisteswissenschaften vorherrschenden ideologischen Verbindung von verfremdeter kritischer Theorie mit dem Poststrukturalismus. Auch hier zeigt sich das Judentum als nicht kompatibel mit der widersprüchlichen Ideologie Butlers oder der Gender Studies insgesamt. Es lässt sich nicht auf ein zwischen Fluidität und Festschreibung (je nachdem, was gerade für die Argumentation gebraucht wird) oszilierendes Identitätsmerkmal reduzieren. Es steht Butlers Gedankengebäude als autonome Gesetzesreligion wie eine Mauer im Weg. Auch das dialogische Prinzip der Wahrheitsfindung im Judentum, die im Talmudstudium angewandt wird, steht dem Verständnis von Wahrheit als Ergebnis von hierarchischen Deutungskämpfen diametral entgegen. Judith Butler als Stichwortgeberin der Gender Studies könnte in diesem Sinne als philosophische Antisemitin bezeichnet werden.
Nur vor diesem Hintergrund ist es zu erklären, dass Wikke Jansen, die Ihre Promotion zum „Verhältnis von Gender, Sexualität und Religion in Indonesien“ schrieb, und bereits die antisemitischen Einlassungen von Masha Gessen und Ghassan Hage verteidigte, es für eine gute Idee hielt, zwei Hamas-Sympathisanten zu einem Vortrag über „Palestinian Activism and (German) Media“ einzuladen. Dort sollte den Vortragenden aller Wahrscheinlichkeit nach die Möglichkeit gegeben werden, sich als Opfer einer Zensur in den deutschen Medien zu gerieren, die es ihnen verbietet, ihre Überzeugung von der Notwendigkeit der Tötung jüdischer Israelis auf allen Kanälen ausbreiten zu dürfen.
Sowohl in den Gender Studies als auch im Postkolonialismus, so wie in von diesen Ideologien beseelten Instituten, wie zum Beispiel dem sich selbst so nennenden „Zentrum für Antisemitismusforschung“, ist man möglichst um die Leugnung jeglichen muslimisch geprägten oder mit Israel in Verbindung stehenden Antisemitismus bemüht, und ist selbst naturgemäß auch unter den schärfsten Israelkritikern zu finden. So merkte der Zentralratsgeschäftsführer Daniel Botman einmal nicht ohne Grund an, dass beim Zentrum für Antisemitismusforschung der Namensbestandteil „-forschung“ im Grunde gestrichen werden könne. Auch die zu Anfang erwähnte Genderforscherin Villa-Braslavski ist gern gesehener Gast am Cornelia-Goethe-Centrum und hat vor ihrem Standardwerk zu „Fat studies“ maßgebliche Texte in der deutschen Rezeption Judith Butlers geschrieben. Der Fairness halber sei erwähnt, dass sie, anders als viele ihrer um die Wissenschaftsfreiheit besorgten Kollegen, einen Aufruf gegen einen Boykott israelischer Universitäten unterschrieben hat. Jedoch untermauert dies nur die Tatsache, dass auch sich nicht selbst antiisraelisch äußernde Angehörige der entsprechenden Institute dabei involviert sind, ihre ideologische Basis untermauern. Dabei ist es beklagenswert, dass der unbedingt begrüßenswerte Kampf um die Emanzipation von Rassismus oder Sexismus betroffener Individuen und Gruppen in seiner akademisierten Form inzwischen so unauflösbar mit einer revanchistischen und vor allem radikal antiisraelischen Ideologie verknüpft ist.
Auch wenn sich diese Denkweise so bald nicht auflösen lassen wird, müsste anhand der Geschehnisse und Einlassungen die Stellung der betroffenen Bereiche der Geistes- und Sozialwissenschaften im gesellschaftlichen Diskurs hinterfragt werden. Deren problematisches Selbstbild wird anhand der Antwort des Heidelberger Professors deutlich, den besorgte jüdische Studierende wegen der antisemitischen Veranstaltung an seinem Institut anschrieben. Laut ihm wäre die „promovierte Mitarbeiterin (…) als Kursleiterin durchaus in der Lage (…), die Meinungen und Ansichten ihrer Gäste zu hinterfragen und wissenschaftlich einzuordnen.“ Dass eine rein politisch-aktivistische Veranstaltung überhaupt etwas mit Wissenschaftlichkeit zu tun hätte, würde in den meisten Teilen des universitären Betriebs auf Befremden stoßen. Im Zuge der poststrukturalistischen Abwendung von Begriffen der Wahrheit und einer geteilten Wirklichkeit kann in den entsprechenden Fächern jedoch so ziemlich alles als Wissenschaft gelten, völlig unabhängig von sonst gültigen Qualitätsmaßstäben wie Logik oder empirischer Nachvollziehbarkeit. Da es an dieser Stelle aber als vorrangige Aufgabe von „Wissenschaft“ angesehen wird, Machtverhältnisse offen zu legen und die „falschen“ Machtverhältnisse umzukehren, ist der Anspruch dieser Art Wissenschaft in erster Linie ein moralischer. Eine „Promovierte Mitarbeiterin“ ist nach diesem Verständnis eher in der Lage, ein moralisch korrektes Urteil über die Inhalte des Vortrages zu fällen als jemand Unpromoviertes, und wahrscheinlich weniger gut als eine habilitierte Person. Dass in Wahrheit wohl das moralische Urteil eines Mitarbeiters im Straßenbau oder einer verdienten Bäckereifachverkäuferin weniger durch die Sicht vom Elfenbeinturm aus verstellt ist, geht in der offensichtlichen Hybris des geistig-kulturellen Betriebs völlig unter. Vor diesem Hintergrund müssen auch die zahlreichen „offenen Briefe“ gesehen werden, die dieser Betrieb absondert, leider auch unter Mithilfe jüdischer Universitätsangehöriger. Wir sollten dies zum Anlass nehmen, den Akademisierungskult im Nachgang der Bildungsoffensive der 60er und 70er Jahre kritisch zu betrachten und den einseitigen moralischen Furor von Angehörigen der Universitäten gegen Israel zurückzuweisen.