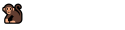Warum wir am Leben hängen (Gracian plus Schopenhauer)
Der südafrikanische Philosoph David Benatar argumentiert in Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into Existence dafür, dass es unmoralisch ist, Kinder auf die Welt zu bringen, und für das Aussterben der Menschheit. Einer der Gründe dafür, dass diese Konklusionen seiner Argumentation, selbst wenn man die Prämissen bejaht und das Argument als gültig ansieht, abgelehnt werden, ist, dass Menschen am Leben hängen. In diesem Artikel geht es nun um eine kurze, vermeintlich pessimistische, und humoristische Begründung mit Gracián und dem (theoretisch, aber nicht praktisch) antinatalistischen Schopenhauer dafür. Warum also hängen Menschen an ihrem Leben?
David Benatar / Richard Dawkins / Charles Darwin
Zunächst jedoch noch eine einfache und offensichtliche Antwort: Benatar hat (soweit bekannt ist) keine Kinder – wie man es typischerweise von antinatalistischen Menschen erwarten sollte. Sollte eine antinatalistische Überzeugung mit bestimmten Genen zusammenhängen, so könnte man mit der auf die Gene gemünzten Evolutionstheorie von Richard Dawkins (The Selfish Gene) erklären können, dass Menschen in der Regel eher pronatalistisch sind und die menschliche Reproduktion befürworten. David Benatar schreibt:
"This bias has its roots in the evolutionary origins of human (and more primitive animal) psychology and biology. Those with pro-natal views are more likely to pass on their genes." (2006:8)
Baltasar Gracián
Doch nun zu der interessanten Perspektive auf den Grund für das Bejahen des Lebens: Das Werk Handorakel und Kunst der Weltklugheit vom spanischen Schriftsteller Gracián wurde u.a. 1832 von Arthur Schopenhauer ins Deutsche übersetzt. Aus dieser Sammlung von Maximen soll die fünfte, Abhängigkeit begründen, helfen, zu erklären, warum Menschen in der Regel am Leben hängen:
"Den Götzen macht nicht der Vergolder, sondern der Anbeter. Wer klug ist, sieht lieber die Leute seiner bedürftig als ihm dankbar verbunden: sie am Seile der Hoffnung führen ist Hofmannsart, sich auf ihre Dankbarkeit verlassen Bauernart; denn letztere ist so vergeßlich als erstere von gutem Gedächtnis. Man erlangt mehr von der Abhängigkeit als von der verpflichteten Höflichkeit: wer seinen Durst gelöscht hat, kehrt gleich der Quelle den Rücken, und die ausgequetschte Apfelsine fällt von der goldenen Schüssel in den Kot. Hat die Abhängigkeit ein Ende, so wird das gute Vernehmen ein solches auch bald finden und mit diesem die Hochachtung. Es sei also eine Hauptlehre aus der Erfahrung, daß man die Hoffnung zu erhalten, nie aber ganz zu befriedigen hat, vielmehr dafür sorgen soll, immerdar notwendig zu bleiben, sogar dem gekrönten Herrn. Jedoch soll man dies nicht so sehr übertreiben, daß man etwa schweige, damit er Fehler begehe, und soll nicht des eigenen Vorteils halber den fremden Schaden unheilbar machen." (Graciáns Handorakel (Projekt Gutenberg))
Gracián empfiehlt also, sich nicht darauf zu verlassen, dass Nettigkeiten erwidert werden. Man soll sich eher darauf einrichten, dass Menschen einem nur zugetan sind, wenn sie einen brauchen. Also sollte man dafür sorgen, dass man immer gebraucht wird. Zu diesem Bedürfnis des Mitmenschen, das man erhalten soll, gesellt man am besten noch die Hoffnung in Kombination mit Unsicherheit. Dies erinnert ein wenig an den Spruch "Willst du was gelten, so mache dich selten." und an die Forschung von Paul Eastwick über ein vermeintliches Problem der "netten" Kerle bei der Partnerwahl: Sie investieren Zeit und Mühe in die Angebetete, und werden durch ihr hündisches Unterwerfen und der ständigen Verfügbarkeit unattraktiv. Gleichzeitig wäre die spieltheoretisch dominante Strategie der Angebeteten, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, aber dennoch dem Verehrer nicht (gänzlich) zu geben, wonach er sich sehnt. (Interessant hierzu ist Casanovas Geschichte meines Lebens. Band 2. Berlin 1964, S. 165 ff. oder Von der Tüchtigkeit des Casanova in Die Braut.)
Arthur Schopenhauer
Für diese pessimistisch-humoristische Antwort auf die Frage, warum Menschen üblicherweise am Leben hängen, ist aus Schopenhauers Werk aus seinen Aphorismen zur Lebensweisheit das Kapitel Kapitel VI. Vom Unterschiede der Lebensalter als Ergänzung zu Gracián nützlich. Hier schreibt Schopenhauer, was das Leben der Jugendlichen ausmacht: Es ist der Anspruch, die Erwartung und die Hoffnung, es gäbe Glück in der Welt. Das macht Menschen in ihrer Jugend unglücklich. (Deu-IV:530) Ein Problem ist dabei auch, dass das Leben der Jugend als "eine unendlich lange Zukunft" (Deu-IV:534) erscheint und somit irgendwann das vermeintlich berechtigt erwartete Glück schon noch kommen würde. Im Hauptwerk Schopenhauers, aber auch im 5. Kapitel der Aphorismen zerstört er diese Hoffnung allerdings, indem er klarstellt, dass das Leben nicht zu genießen, sondern zu überstehen sei; und indem er auf eine Asymmetrie zwischen Freuden und Genüssen verweist:
"Denn die Genüsse sind und bleiben negativ: daß sie beglücken, ist ein Wahn, den der Neid, zu seiner eigenen Strafe, hegt. Die Schmerzen hingegen werden positiv empfunden: daher ist ihre Abwesenheit der Maaßstab des Lebensglückes. Kommt zu einem schmerzlosen Zustand noch die Abwesenheit der Langenweile; so ist das irdische Glück im Wesentlichen erreicht: denn das Uebrige ist Chimäre." (Deu-IV:449)
Gracián-Schopenhauer-Synthese zum Lebenswillen
Zu guter Letzt bleibt noch die Einsetzung zu erledigen: Warum hängen Menschen in der Regel am Leben? Gracián verrät mit seiner machiavellistische Maxime auch des Menschen Wunsch zu leben, nämlich seine Abhängigkeit. Das Leben ist das Abhängigmachende, besonders mit Schopenhauers Darstellung über Hoffnung, Glück und Leid. Gracián dürfte man mit Blick auf die Frage dieses Artikels folgendermaßen umformulieren:
"Das Leben wird als falscher Gott angebetet, da es sich nicht auf Dankbarkeit, sondern auf Abhängigkeit verlässt. Die Lebenden sind vom Leben abhängig, weil sie sich von ihm Glück erhoffen. Sie sind voller Bedürfnisse, die sie nie gänzlich, aber immer mal wieder teilweise befriedigen können. Da die Bedürfnisse nie aussterben, und die Hoffnung ebenso wenig, bejahen die Lebenden weiterhin das Leben und bleiben in dieser Abhängigkeit, da das Leben weiterhin Glück zu versprechen scheint. Sollte das Leben den Lebenden mal im Stich lassen und unerträgliches Leid über ihn bringen, so könnte er depressiv und suizidal werden. Erfüllen sich dagegen dem Lebenden alle Bedürfnisse, dann hat er Langeweile (Schopenhauer) und daher wieder das Bedürfnis nach Zerstreuung – oder es reift die Erkenntnis, dass alles erhoffte Glück letztlich nichts wert ist und man entzieht sich dem Leben, sodass man den Willen asketisch verneint (Schopenhauer) oder den Freitod wählt, wie es der ebenso antinatalistischen Schopenhauer-Schüler Philipp Mainländer tat."