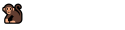Schopenhauers Nähe zum Christentum
"Ueberhaupt legte sein geistlicher, sogar bischöflicher Stand ihm zu schwere Fesseln an und beschränkte ihn auf einen beengenden Gedankenkreis, gegen er nirgends anstoßen durfte, sondern, in seinem Kopfe, Wahres und Falsches lernen mußte, sich zu vertragen, so gut es gehn wollte.", meinte Schopenhauer über den englischen Empiristen George Berkeley (Skitze einer Geschichte..., Band 1 der Parerga). Nicht nur mit diesem Zitat scheint es, ob als Schopenhauer keine Nähe zum Christentum gehabt hatte. Schopenhauer war ein Atheist in dem Sinne, dass er nicht an einen Gott glaubte, vielleicht aber nicht in dem Sinne, dass er glaubte, dass kein Gott existiere. Nietzsche fand jedenfalls lobende Worte über Schopenhauer, der "als Philosoph der erste eingeständliche und unbeugsame Atheist [war], den wir Deutschen gehabt haben" (Fröhliche Wissenschaft) Wie Frederick Beiser im Buch "Weltschmerz" darstellt, war der Unterschied zwischen Schopenhauers Lehre und dem Christentum allerdings nicht besonders groß.
Die Erbsünde im Christentum und bei Schopenhauer
Für Schopenhauer waren die Erbsünde und die Erlösung die Essenz des Christentums (§182., Kap. XV. des 2. Bands der Parerga).
Die Erbsünde im Christentum: "Die Weitergabe der Erbsünde ist jedoch ein Geheimnis, das wir nicht völlig verstehen können. Durch die Offenbarung wissen wir aber, daß Adam die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht für sich allein erhalten hatte, sondern für die ganze Menschennatur. Indem Adam und Eva dem Versucher nachgeben, begehen sie eine persönliche Sünde, aber diese Sünde trifft die Menschennatur, die sie in der Folge im gefallenen Zustand weitergeben [Vgl. K. v. Trient: DS 1511-1512.]. Sie ist eine Sünde, die durch Fortpflanzung an die ganze Menschheit weitergegeben wird, nämlich durch die Weitergabe einer menschlichen Natur, die der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit ermangelt. Deswegen ist die Erbsünde ‚Sünde‘ in einem übertragenen Sinn: Sie ist eine Sünde, die man ‚miterhalten‘, nicht aber begangen hat, ein Zustand, keine Tat." (Ecclesia Catholica: Katechismus der Katholischen Kirche. (1997) Nr. 404)
Eine vergleichbare Erbsünde bietet Schopenhauer: "Das Leben stellt sich dar als eine Aufgabe, ein Pensum zu Abarbeiten, und daher, in der Regel, als ein steter Kampf gegen die Not. Demnach sucht Jeder durch und davon zum kommen so gut es gehen will: er thut das Leben ab, wie einen Frohndienst, welchen er schuldig war. Wer aber hat diese Schuld kontrahirt? - Sein Erzeuger, im Genuß der Wollust. Also dafür, daß der Eine diese genossen hat, muß der Andere leben, leiden und sterben." (WWVII, Kap 45). Damit ist nicht nur die Ähnlichkeit zwischen Arthur Schopenhauer und der christlichen Lehre klar, sondern auch, dass Schopenhauer wenigstens in modernen Zeiten der Kinderplanung eine bewusste Entscheidung für Nachwuchs als egoistisch bezeichnen würde.
Ein Mensch ist nach Schopenhauer allerdings schon für sich genommen ein Sünder, da der Wille in ihm nur nach der Erfüllung eigener Bedürfnisse strebt. Egoismus alleine ist nicht notwendig ein Übel, aber er führt in der Regel zur Missachtung von moralischen Prinzipien - wenn nicht in Taten, dann wenigstens in Absichten. Daher sind wir alle Sünder und verdienen unser Leid (Beiser, Kap. 5).
Die Bedeutungslosigkeit des Diesseits
Schopenhauers Ansichten zur Bedeutungslosigkeit dieser Welt sind bekannt: "besagte Geschichts-Philosophen und -Verherrlicher sind demnach einfältige Realisten, dazu Optimisten und Eudämonisten, mithin platte Gesellen und eingefleischte Philister, zudem auch eigentlich schlechte Christen; da der wahre Geist und Kern des Christenthums, eben so wie des Brahamanismus und Buddhaismus, die Erkenntniß der Nichtigkeit des Erdenglücks, die völlige Verachtung desselben und Hinwendung zu einem ganz andersartigen, ja, entgegengesetzten Daseyn ist: Dies, sage ich, ist der Geist und Zweck des Christenthums, der wahre "Humor der Sache"; [...]" (WWVII, Kap 38).
Damit wird auch schon wieder die Nähe zum Christentum deutlich. Die Bibel bietet zur Bedeutungslosigkeit des Diesseits noch mehr: "Was [einst] gewesen ist, das wird [wieder] sein, und was [einst] geschehen ist, das wird [wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne."(Prediger 1.9), "Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind!" (Prediger 1.14) und "Ich dachte in meinem Herzen: Auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen! Aber siehe, auch das ist nichtig!" (Prediger 2.1).
Das Diesseits ist für Schopenhauer nicht nur bedeutungslos, sondern auch schlecht: „Allerdings hat man, wann man alt ist, nur noch den Tod vor sich; aber wann man jung ist, hat man das Leben vor sich; und es frägt sich, welches von Beiden bedenklicher sei, und ob nicht, im Ganzen genommen, das Leben eine Sache sei, die es besser ist hinter sich, als vor sich zu haben […]“ (Aphorismen, Kap VI)
Die Erlösung im Christentum und bei Schopenhauer
Wie das Christentum bietet auch Schopenhauer Erlösung an: Mitgefühl und Askese sind dafür notwendig. Dies gelingt allerdings bloß Heiligen oder Genies (ein Tropf bleibt ein Tropf). Während im Christentum entweder alleine durch den Glauben an Gott (Luther: "sola fide") oder der Empfang der Sakramente und ein gottgefälliges Leben nach dem Katechismus (Katholiken) zur Erlösung führen, ist bei Schopenhauer neben Mitgefühl noch die Verneinung des Willens notwendig, also das Verneinen aller Bedürfnisse und Wünsche. Man muss indifferent zum eigenen Wohl werden und wie ein Zuschauer auf das eigene Leben schauen. Dabei muss man allerdings mitfühlen mit Mitmenschen und Tieren, da man in ihnen den Willen erkennen kann, der auch uns zugrundeliegt.
Fazit
Schopenhauers Lehre ist nah am Christentum. Bei Schopenhauer und im Christentum liegt in dieser Welt, also im Diesseits, kein wahres Glück. Während das Christentum ein Jenseits proklamiert - und natürlich einen personalen Gott -, verzichtet Schopenhauer auf diese metaphysischen Thesen. Für Schopenhauer hat der Mensch das Leid verdient und kann durch Askese und Mitleid Erlösung erlangen und damit negatives Glück, also Leidfreiheit. Im Gegensatz zum Himmel des Christentums verspricht Schopenhauer keine bessere Welt als die schlechte, in der wir zu leben haben - also keine "frohe Botschaft".
Literatur:
Frederick Beiser, Weltschmerz. Pessimism in German Philosophy, 1860-1900, Oxford 2016. Die Welt als Wille und Vorstellung Band 1 und 2.
Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft. Fünftes Buch, Aphorismus 357 "Zum alten Probleme: »was ist deutsch?«" (KSA 3, S. 599 ff.). Hochspringen (http://www.textlog.de/21463.html).
Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena.
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung.
Bibel (SCH2000).
Ecclesia Catholica: Katechismus der Katholischen Kirche. (1997) Nr. 404) http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P1J.HTM#9Y