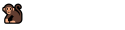Schopenhauers metaphysische Grundlage für den Pessimismus
Ziel Schopenhauers Philosophie ist es, das Wesen der Welt und gleichermaßen die Bedeutung und den Wert des menschlichen Lebens zu deuten. Dazu gehören für Schopenhauer die Metaphysik und die Ethik gleichermaßen.
Metaphysik
Während Kant in der Kritik der reinen Vernunft die Möglichkeit einer Metaphysik ausschließt, da er meint, zu ihr gäbe es nur den Erkenntnisweg der reinen Vernunft, nicht aber einen empirischen, sieht Schopenhauer eine Möglichkeit für die Metaphysik. Wie Kant muss auch für ihn Grundlage jeder Erkenntnis die Erfahrung sein. Seiner Ansicht nach ist allerdings Metaphysik nicht nur transzendent, sondern auch immanent. Er unterscheidet zwischen:
- dem Was, also die Essenz, der Inhalt oder das Ding an sich (ohne Relationen). Das ist rein qualitativ. Dies fällt zumindest teilweise in das Gebiet der Metaphysik.
- und dem Warum, also Ursachen, die Form und die Relation zu anderen Dingen. Dies ist quantitativ und fällt wenigstens teilweise (bis auf die erste Ursache) in den Bereich der Naturwissenschaft.
Das Ding an sich ist nach Schopenhauer kein mystisches Ding, das Erscheinungen bewirkt und hinter ihnen ist – bei Kant allerdings auch nicht, sondern eine Abstraktion von den Kategorien unseres Erkennens - sondern das als Erscheinung Manifestierte.
Von allen Dingen in der Welt kennt jeder Mensch schon eines recht gut: sich selbst. Das Bewusstsein wird weder bei Kant noch bei Schopenhauer infrage gestellt - vermutlich auch bei sonst keinem. Menschen haben zwei Perspektiven, um sich zu erfahren:
- unmittelbar von innen, mit dem Willen, Gedanken und Gefühlen/Emotionen. Darüber erblickt ein Mensch ein Ding an sich von innen.
- von außen als ein Objekt, wie andere Erscheinungen von Objekten auch.
Diese beiden Seiten gehören für Schopenhauer notwendig zusammen. Diese vereinigen sich im eigenen Körper.
So teilt Schopenhauer die Welt auch in Wille und Vorstellung:
| Die Welt als Wille | Die Welt als Vorstellung |
| genau ein Wille in der Welt in (An-)Organischem (induktiv auf Fremdpsychisches geschlossen + ein Wille als Ding an sich) |
nur Erscheinungen |
| empirischer Realismus | Kants Transzendentaler Idealismus, der Metaphysik zerstört |
| Objekt als Ausgangspunkt | Subjekt als Ausgangspunkt |
| gegeben: Welt | gegeben: Bewusstsein |
| Materialismus | Idealismus |
| Bedeutung hinter Erscheinungen | Erscheinungen |
| nach Platon: Idee | nach Platon: Abbild |
Nur einen einzigen Willen hinter Steinen, Pflanzen, Tieren und Menschen gibt es, weil Objekte durch die Kategorien von Raum und Zeit individuiert werden. Der Wille, als Naturkraft (wie Naturgesetze) zu verstehen ist, erkennt sich im Menschen selbst: "Erst nachdem das innere Wesen der Natur (der Wille zum Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche der bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüstig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei. Seine Verwunderung ist aber um so ernstlicher, als es hier zum ersten Male mit Bewußtsein DEM TODE gegenübersteht, und neben der Endlichkeit alles Daseyns auch die Vergeblichkeit alles Strebens sich ihm mehr oder minder aufdringt. Mit dieser Besinnung und dieser Verwunderung entsteht das dem Menschen allein eigene BEDÜRFNISS EINER METAPHYSIK [...]" (WII, Kap. 17)
Pessimismus
Der Pessimismus folgt für Schopenhauer logisch aus seinen metaphysischen Erkenntnissen, da der Wille rastlos, blind, irrational und destruktiv ist. Der Wille führt zu Leid. Der Mensch ist die höchste Form der Objektivation, also Manifestation des Willens mit dem höchsten Grad an Bewusstsein. Daher kommt dem Mensch auch das meiste Leid zu. So besteht das Leben für (gewöhnliche) Menschen nur aus Leid, bzw. Leid oder Langeweile, wobei Langeweile auch ein Leid ist. ”Denn in der Einsamkeit, als wo Jeder auf sich selbst zurückgewiesen ist, da zeigt sich was er an sich selber hat: da seufzt der Tropf im Purpur unter der unabwälzbaren Last seiner armsäligen Individualität; während der Hochbegabte die ödeste Umgebung mit seinen Gedanken bevölkert und belebt.” (Aphorismen, Kap II)
Real, also positiv, ist nur Leid. “Wir fühlen den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit; die Sorge, aber nicht die Sorglosigkeit; die Furcht, aber nicht die Sicherheit. [...]” (WII, Kap. 46). Damit steht er in der Tradition Epikurs und der Stoiker.
Während Leibniz argumentiert, dass wir in der besten aller Welten leben, weil Gott allmächtig und allgütig ist, meint Schopenhauer, dass wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben. So meint er: "Allerdings hat man, wann man alt ist, nur noch den Tod vor sich; aber wann man jung ist, hat man das Leben vor sich; und es frägt sich, welches von Beiden bedenklicher sei, und ob nicht, im Ganzen genommen, das Leben eine Sache sei, die es besser ist hinter sich, als vor sich zu haben [...]" (Aphorismen, Kap VI)
Selbstmord lehnt Arthur Schopenhauer allerdings mehrfach ab: "Weit entfernt Verneinung des Willens zu seyn, ist dieser ein Phänomen starker Bejahung des Willens. Denn die Verneinung hat ihr Wesen nicht darin, daß man die Leiden, sondern daß man die Genüsse des Lebens verabscheuet. Der Selbstmörder will das Leben und ist bloß mit den Bedingungen unzufrieden, unter denen es ihm geworden." (WI, §69)
Schopenhauers Pessimismus muss allerdings nicht auf einer solchen Metaphysik aufgebaut sein. Pessismismus könnte man auch ohne eine Metaphysik denken, mit Empririe ohne metaphysische Schlüsse. Im letzten Zitat wird klar, was für Schopenhauer die Lösung aus dem Zustand der Welt ist: Die Verneinung der Genüsse, also den Willen zu verneinen.
Literatur: Frederick Beiser, Weltschmerz. Pessimism in German Philosophy, 1860-1900, Oxford 2016. Die Welt als Wille und Vorstellung Band 1 und 2. Aphorismen zur Lebensweisheit.