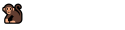Rousseau und Schopenhauer: der Wille und das Individuum
Bei Arthur Schopenhauer dreht sich alles um den Willen: Wenn er die Themen Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik behandelt, so spricht er in jedem dieser vier Bücher seines Hauptwerkes "Die Welt als Wille und Vorstellung" von 1818 bloß einen einzigen Gedanken aus: "Die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens." oder: "Die Welt ist meine Vorstellung und ich bin bloß eine Objektivation des Willens."
Auch bei Rousseau findet sich der Begriff des Willens. Zum einen kennt er die Einzelwillen von individuellen Menschen (Volonté particulière) und die Summe aller Einzelwillen (Volonté de tous), zum anderen kennt er seinen ganz besonderen Willen, den einen auf das Allgemeinwohl ausgerichteten Gemeinwillen (Volonté générale).
Sowohl Schopenhauer als auch Rousseau verbinden mit dem Willen bzw. mit einem solchen Begriff eine ganze Menge, insbesondere die Lösung ethischer Probleme. Die Besonderheit steckt allerdings im Verhältnis von Willen zum Individuum. Im Folgenden wird die Anstrengung unternommen, zu zeigen welche großen Übereinstimmungen zwischen den Konzepten beider Autoren lesbar sind.
Dieser kurze Artikel soll nun ein Versuch sein, die (wenigstens) sprachliche Nähe beider Philosophen kurz zu erläutern und zu zeigen, inwiefern man Schopenhauer und Rousseau ähnlich verstehen kann. Dies ist keine gründliche, wissenschaftliche Arbeit und diskutiert daher nicht bis in die Tiefe, wie die jeweiligen Begriffe verstanden werden könnten - wenn nicht in der vorgeschlagenen Art und Weise.
Rousseaus "Gemeinwille"
Als "Gemeinwille" versteht Rousseau je nach Lesart entweder Anstrengungen, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind oder aber ein metaphysischen Konstrukt, in welchem Individuen gleich den Organen eines Körpers sich zu einem Organismus mit einem einzigen Willen vereinigen.
Jean-Jacques Rousseau wird in der Literatur immer wieder mit Namen wie Robespierre, Lenin, Stalin und Hitler in Verbindung gebracht. Dass Rousseau, einer der Idole der Revolutionäre von 1789, mit totalitären Diktatoren in Verbindung gebracht wird, liegt an Zitaten wie diesen:
„Wer dem Gemeinwillen den Gehorsam verweigert, wird von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen. Was nichts anderes heißt, als daß man ihn dazu zwingt, frei zu sein.“
Nach Rousseau kann man innerhalb einer Gesellschaft nur frei leben, wenn es einen Gesellschaftsvertrag gibt. Dieser Vertrag muss auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Er gibt den Bürgern, die in ihrer Summe den Souverän darstellen, Rechte; dafür erhalten sie in ihrer Rolle als Untertanen Pflichten. Das ist also eine Selbstgesetzgebung: Wer Bürger ist, ist frei. Dafür muss er aber auch Untertan sein - und sich dem Gemeinwillen unterwerfen. Wer nicht Untertan ist, darf zur Freiheit gezwungen werden.
Mehr noch als die Unterwerfung verlangt Rousseau von Individuen. Sie sollen nicht mehr sein, es darf keine individuellen Willen mehr geben, bloß noch den einen Willen der Gesamtheit.
"Das heißt: erst wenn kein Bürger mehr etwas ist oder vermag, es sei denn durch alle anderen, und wenn die dank der Gesamtheit erworbene Kraft der Summe der natürlichen Kräfte aller Individuen gleichkommt oder sie übersteigt – erst dann ist die Gesetzgebung auf dem höchsten Punkt der ihr möglichen Vollendung angelangt."
Noch zweite Zitate sollen die These stützen, dass Individuen nichts gelten und sich dem Gemeinwillen zu unterwerfen haben. Aus Rousseaus Erziehungsroman:
„Der natürliche Mensch ist ein Ganzes für sich; er ist die numerische Einheit, das absolute Ganze, das nur zu sich selbst oder zu seinesgleichen in Beziehung steht. Der bürgerliche Mensch ist nur eine gebrochene Einheit, welche es mit ihrem Nenner hält, und deren Wert in ihrer Beziehung zu dem Ganzen liegt, welches den sozialen Körper bildet. Die guten sozialen Einrichtungen vermögen den Menschen am ehesten seiner Natur zu entkleiden, ihm seine absolute Existenz zu rauben, um ihm dafür eine relative zu geben, und das Ich in die allgemeine Einheit zu versetzen, so daß sich jeder einzelne nicht mehr für eine Einheit, sondern für einen Teil der Einheit hält und nur noch in dem Ganzen wahrnehmbar ist. Ein römischer Bürger war nicht Cajus, nicht Lucius, er war ein Römer [...]“
Und noch Rousseau über die Zensur:
"Wie sich der Gemeinwille im Gesetz ausdrückt, so die öffentliche Meinung in der Zensur. Die öffentliche Meinung ist eine Art Gesetz, als dessen Sachwalter der Zensor fungiert […] Das Zensorenamt richtet also keineswegs über die Volksmeinung, sondern ist nur deren Sprachrohr."
Der Zensor macht, was das Volk wirklich will, auch wenn es nicht weiß, was es will. Das Volk kann viele Willen äußern, doch es gibt nur einen richtigen: den Gemeinwillen.
Woher kommt nun aber der Gemeinwille? Wer erkennt ihn wie? Rousseau meint, der Gemeinwille kann nie irren, doch das Volk erkennt ihn nicht immer, es täuscht sich leicht. Eine Anleitung bietet Rousseau nicht an. Überhaupt definiert er den Gemeinwillen kaum mal positiv, er sagt mehr darüber, was er nicht ist.
Damit ist es einfach vorstellbar, wie etwa ein Robespierre oder Lenin sich mit einer vermeintlichen (Er-) Kenntnis des Gemeinwillen ihre Herrschaft legitimieren. Sie wissen besser, was das Richtige für das Volk ist und dürfen es zwingen, frei zu sein. Was gilt das Individuum, wenn es um das ganze Volk geht? Was darf das Volk gegen einen Führer sagen, wenn es doch keine Ahnung hat?
Schopenhauers Wille
Bei Schopenhauer ist alles, was in der Welt ist, vom Stein über Pflanzen bis hin zu Lebewesen wie Hunde, Katzen, Affen oder Menschen, eine Objektivation des Willens, des einen Willens. Der eine, metaphysische Wille ist des Pudels Kern, das Ding an sich vom allem, was existiert.
„Erst nachdem das innere Wesen der Natur (der Wille zum Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche der bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüstig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei.“ (Kap 17)
Zu dieser Erkenntnis hat, so Schopenhauer, jeder selbst einen Zugang, in dem er in sich selbst hineinschaut und in sich individuelle Willensregungen entdeckt. Wenn ein Mensch in sich schaut und entdeckt, dass er nur eine Individuation des einen Willens ist, erkennt er, dass jedes Wesen, mit dem er in Berührung kommt, nur eine Erweiterung seiner Selbst ist. In §66 bringt Schopenhauer die Konsequenzen dieser Erkenntnis zum Ausdruck: Alles Lebende ist eben so wohl unser eigenes Wesen an sich, wie die eigene Person. Das eigene Herz wird erweitert. Wer gut sein will, macht keinen Unterschied zwischen sich und anderen. Das fremde Leid wird nämlich zum eigenen Leid, wenn man erkennt, dass es keinen Unterschied zwischen Fremden und sich gibt:
„Alle Quaalen Anderer, die er sieht und so selten zu lindern vermag, alle Quaalen, von denen er mittelbar Kunde hat, ja die er nur als möglich erkennt, wirken auf seinen Geist, wie seine eigenen.“ (§68)
Das ist Arthur Schopenhauers bekannte Mitleidsethik: Leid wird erzeugt, wenn man den eigenen Bedürfnissen hinterherjagt, eigenes wie fremdes. Leid wird gemindert, wenn man erkennt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen sich und den Mitmenschen (wie auch anderen Lebewesen und Dinge).
Fazit
Das Individuum ist ein Problem. Individualität passt nicht gut in die Gesellschaft, daher muss sie überwunden werden – so kann man Rousseau leicht lesen. Auch mit Schopenhauer ist die Überwindung der Individualität eine Lösung, um Leid zu mindern. Und in den Konzepten beider Philosophen ist es der individuelle Wille, der dem Gemeinwohl entgegensteht.
In dieser Auswahl der Zitate kommt Rousseau negativer als Schopenhauer weg. Das liegt zum einen daran, dass für diesen Artikel bewusst eine bestimmte Lesart gewählt wurde – diese ist nicht unumstritten. Zum anderen liegt es daran, dass auch bei Schopenhauer eine bewusste Auswahl an Textstellen getroffen wurde. Es ist bei Schopenhauer möglich, eine Auswahl zu treffen, die weit weniger menschenfreundlich wirkt.
Ergebnis dieses, vielleicht verunglückten Versuches, Schopenhauer und Rousseau mit ihren Willen und deren Verhältnis zur Individualität darzustellen, ist wohl, dass nur mit einer sehr speziellen Lesart von Rousseau eine metaphysische Entität zustande kommt, die sich mit Schopenhauers Willen vergleichen lässt. Abgesehen davon allerdings, bleibt dennoch die bei Rousseau und Schopenhauer vorhandene Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft, die allerdings bei jedem anderen Philosophen zu erwarten ist. Es gibt letzten Endes keine besondere Ähnlichkeit zwischen Rousseau und Schopenhauer, die über den Begriff "Wille" hinausgeht.
Literatur: Joshua Cohen, Rousseau. A Free Community of Equals, New York 2010. Karlfriedrich Herb, Verweigerte Moderne. Das Problem der Repräsentation, in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 167ff. Tobias Hürter, Das Kleingedruckte einer lauten Zeit, in: Hohe Luft. Ausgabe 3/2017, S. 33ff. Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002. Günther Mensching, Jean-Jacques Rousseau zur Einführung, Hamburg 2000. Patrick Riley, Eine mögliche Erklärung des Gemeinwillens (I 7, II 1-3), in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 107 ff. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008. Jean-Jacques Rousseau, Emil oder Über die Erziehung. Band 1 erstes Buch, Leipzig [o.J.], [http://www.zeno.org/nid/20009264205] letzter Zugriff am 25.08.2018. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Band 1 und 2, Frankfurt 2006.