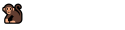Quaestio: Ist das Leben lebenswert?
Es fragt sich (in dieser nicht ganz ernst gemeinten Quaestio), ob das Leben lebenswert ist.
Man könnte schnell zu dem Schluss kommen, dass das Leben nicht lebenswert sei:
Erstens, laut Schopenhauer ist nur das Leid positiv zu erleben, Glück nicht. Beispielsweise spüren Menschen Schmerzen, Furcht und Sorgen, nicht aber Schmerzlosigkeit, Sorglosigkeit und Sicherheit (WII, Kap. 46). Daher besteht das Leben nur aus Langeweile und dem Leid. Nach Epikur ist der Tod für uns ein Nichts, da er ist, wenn wir nicht fühlen, und wir sind, wenn er nicht da ist. (Menoikeus) Daher ist das Nichtleben dem Leben vorzuziehen (Aphorismen Kap VI).
Zweitens, wenn im Leben das Leid die Lust überwiegt, so ist es nach Eduard von Hartmann nicht lebenswert. Für ihn gibt es mehr Leid als Lust (1873:656). Dies folgert er daraus, dass sowohl Leid als auch Lust mit wachsender Dauer oder Intensität Körper oder Geist stärker ermüden. Aus einer Ermüdung folgt ein Bedürfnis, das ermüdende Gefühl zu beenden. Bedürfnisse sind Leiden. Also ist das Leben nicht lebenswert.
Schopenhauer meinte drittens, dass Wünsche oder Mängel die Vorbedingung aller Genüsse seien. Daher könne ein Glück nie mehr sein als eine Befreiung von Schmerzen oder Nöten (§58). Tausend Genüsse sind für Schopenhauer nicht eine Qual wert (Kap 46). Also ist das Leben nicht lebenswert.
Es scheint also, als ob die wichtige und bedeutende Frage nach der Lebenswertigkeit des Lebens mit “nein” beantwortet werden müsste.
Allerdings meinte Leibniz dem zuwider, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, da ein gütiger und allmächtiger Gott nur eine Welt wollen könnte, die so gut wie möglich ist, und eine solche auch erschaffen kann. Im Gegensatz zu Gott können Menschen das Theodizee-Problem nicht objektiv bewerten.
Dem beipflichtend ist Folgendes hinzuzufügen: Komposita aus dem Wort „wert“ und einem vorausgeschickten Verb, wie „nennenswert“, „lobenswert“ oder „liebenswert“ beschäftigen sich stets mit der Frage, ob eine Entität einen Wert hat, der einen hinreichenden Grund liefert, die Tätigkeit des Verbs vor dem „wert“ auszuüben. Es geht um eine Wahl. Ungeachtet der Frage der Willensfreiheit beinhaltet diese Wahl die Möglichkeit eine Entität entweder zu nennen, zu loben, zu lieben oder jeweils es nicht zu tun. Diese Frage stellt sich vor der angegebenen Tätigkeit des Verbs. Bedingung aller genannten Komposita, wie auch des Kompositums „lebenswert“, ist allerdings das Leben. Ohne zu leben steht niemand vor einer Wahl. Vor dem Leben hat niemand eine Wahl, nur im Leben hat man eine Wahl. Laut von Hartmann unterliegen die meisten Menschen im Leben den Illusionen, es ginge im Leben um erreichbares Glück (1871:698). Im Leben sind Illusionen möglich und Gewöhnung an das Leben und seine Umstände wahrscheinlich. Aus dem Leben heraus kann man das Leben also nicht objektiv bewerten.
Zum ersten Einwand: Nach Rudolph Haym kann man die Nicht-Existenz nicht mit der Existenz vergleichen. Der einzige Standpunkt, den Menschen einnehmen können ist einer aus der Existenz heraus. Daher macht diese Frage keinen Sinn.
Zum zweiten Einwand: Glück und Leid sind nur quantitativ vergleichbar, wenn diese Gefühle Dimensionen haben, die wenigstens ordinalskaliert werden können. Glück und Leid haben laut J. B. Meyer allerdings auch eine qualitative Dimension. Damit sind Glück und Leid nicht vergleichbar und die Frage macht keinen Sinn.
Zum dritten Einwand: Der Freude über das Unglück anderer Menschen (Schadenfreude) geht kein eigenes Glück zuvor. Also hat nicht jedes Glück ein (eigenes) Leid als Vorbedingung. Diese Instanz widerlegt somit den dritten Einwand.
Literatur: Frederick C. Beiser, Weltschmerz. Pessimism in German Philosophy, 1860-1900, Oxford 2016. Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung. Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit. Epikur: Brief an Menoikeus.