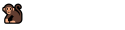Kreditsicherheiten
Mit Kreditsicherheiten will sich der Gläubiger gegen eine Zahlungsunfähigkeit des Schuldners absichern. Er besitzt zwar ein Anspruch auf Rückzahlung, allerdings kann der Schuldner dennoch zahlungsunfähig werden. Für die Schulden haftet der Schuldner mit seinem gesamten Vermögen.
Wenn der Schuldner nicht zahlen kann, oder will, dann muss zunächst das "Recht haben" geklärt werden. Wenn ein Darlehensvertrag besteht und der Schuldner nicht zahlt, ist der nächste Schritt das "Recht bekommen": Es muss geklagt werden. Falls der Schuldner weiterhin das Zahlen verweigert, muss das Recht durchgesetzt werden. Dazu gibt es unter anderem die Mittel Gerichtsvollzieher und die Kontopfändung. Wenn damit kein Geld zu machen ist, gibt es noch die Sicherheiten. Bei den Sicherheiten gibt es zwei Typen: Personalsicherheiten und Sachsicherheiten.
Personalsicherheiten
Bürgschaft
Wenn zwischen A und der B Bank nach §488 BGB ein Darlehensvertrag besteht und C eine Bürgschaft für A eingeht (also nach §768 BGB ein Bürgschaftsvertrag zwischen C und B besteht), dann muss C im Falle der Zahlungsunfähigkeit von A die Schuld begleichen. Nach §766 BGB ist für die Bürgschaft die Schriftform notwendig. Diese ist in §126 BGB definiert. Allerdings ist eine Bürgschaftszusage nach §350 HGB auch mündlich wirksam, wenn es sich um Kaufleute handelt. Eine der Hauptfunktionen der Schriftform ist nämlich die Warnfunktion. Wenn es sich um Kaufleute handelt, muss man davon ausgehen, dass diese wissen, welche Risiken sie eingehen. Zweck des Handelsgesetzbuches, einem Sonderprivatrecht für Kaufleute, ist es, dass BGB so zu modifizieren, dass für den Alltag der erfahrenen Kaufleute die Abwicklung rechtlicher Prozesse schneller möglich ist.
Nach §771 BGB kann ein Bürge vom Gläubiger verlangen, dass dieser erst die Schuld vom Hauptschuldner mittels Zwangsvollstreckung zu befriedigen versucht. Allerdings kann der Bürge im Bürgschaftsvertrag nach §773 BGB auch auf die Einrede der Vorausklage verzichten und §773 BGB bietet noch andere Ausnahmefälle.
Die Bürgschaft ist akzessorisch. Das heißt, dass die Schuld des Bürgen nur abhängig von der Schuld des Hauptschuldners besteht.
Die Bürgschaft bedarf der Schriftform. Eine Ausnahme sind die Kaufleute. Außerdem ist die Schriftform nachträglich nicht mehr notwendig, wenn die Bürgschaft schon geleistet wurde. Der Formmangel ist dann geheilt.
Von der Bürgschaft gibt es mehrere Varianten. Ausfall, Höchstbetrag und Bürgschaft auf erstes Verlangen.
Bei einer Bürgschaft auf erstes Verlangen besteht die Pflicht des Bürgen beim Verlangen des Gläubigers die Schuld zu begleichen, auch wenn die Schuld des Hauptschuldners unbeglichen verjährt ist.
Garantieversprechen
Garantieversprechen sind nicht im Gesetz geregelt, dennoch im Rahmen der Vertragsfreiheit möglich. Sie sind nicht akzessorisch und dazu formfrei. Diese Art der Personalhaftung ist wesentlich umfangreicher als die Bürgschaft. Daher geht man im Zweifel von einer Bürgschaft aus.
Bei einer mündlichen Erklärung, dass sich A für Verbindlichkeiten des C gegenüber B stark macht, stellt sich zunächst die Frage, ob es ein Garantieversprechen oder eine Bürgschaft ist. Wenn es eine Bürgschaft ist, muss es sich um Kaufleute handeln, weil sonst ein Formmangel besteht. Wenn B davon ausgehen muss, dass A für das Begleichen der Verbindlichkeiten des C garantiert, dann handelt es sich um ein Garantieversprechen.
Patronatserklärung
Auch die Patronatserklärung ist nicht gesetzlich geregelt. Diese Erklärung gibt es bei Konzernen für die Verbindlichkeiten der Töchter. Die Patronatserklärung ist hart und weich möglich. Bei der harten Erklärung haben Gläubiger auch gegenüber dem Konzern den Anspruch, bei der weichen handelt es sich bloß um den guten Willen des Konzerns. Eine Zahlung erfolgt grundsätzlich nur an den Schuldner.
Sachsicherheiten
Forderungen und Rechte
Als Sicherheit kann ein Pfandrecht dienen. Dazu gelten §§1279f. BGB. Aufgrund der Anzeigepflicht ist es allerdings ein unbeliebtes Mittel. Die Verpfändung einer Forderung bedarf nämlich der Anzeige des Gläubigers gegenüber dem Schuldner.
Als Grundlage für die Sicherungszession, also auch die Abtretung einer Forderung, dient §398 BGB. Hierbei wird eine Forderung abgetreten. Bei Begleichung der Schuld ist allerdings eine Rückabtretung der Forderung notwendig. Das kann man vertraglich im Abtretungsvertrag automatisch regeln. Diese Form ist ähnlich der Sicherungsübereignung. Zwar ist diese Sicherheit nicht akzessorisch, allerdings kann man das im Sicherungsvertrag vereinbaren. Problematisch kann diese Sicherheitsform wegen der Globalzession sein. Die Abtretung einer Vielzahl von Forderungen ist eventuell wegen §138 BGB sittenwidrig.
Mit §398 BGB ist eine stille Zession (=Abtretung) einer Forderung möglich. Wenn ein Händler als Sicherung eine Forderung gegen einen Kunden der Bank abtritt, könnte sein Ruf geschädigt werden. Mit einer vertraglich vereinbarten Einzugsermächtigung des Händlers würde der Kunde die Abtretung der Forderung nicht merken.
Bewegliches Vermögen
Bei beweglichem Vermögen gibt es das Pfandrecht als Option. Allerdings ist das Pfandrecht ziemlich unbrauchbar wegen §1205 BGB. Es wird die Übergabe der Sache verlangt. Hierzu mehr bei der Übereignung von beweglichen Sachen.
Dazu gibt es die Sicherungsübereignung aus §930 BGB. Hier wird die Übergabe durch ein Besitzkonstitut ersetzt. Diese Form der Sicherung ist auch nicht akzessorisch.
Außerdem gibt es den Eigentumsvorbehalt. Der Erwerber wird unter einer aufschiebenden Bedingung (Kaufpreiszahlung) der neue Eigentümer. Problematisch ist das aufgrund von §950 BGB. Gelöst wird das wiederum mit einem verlängertem Eigentumsvorbehalt, also der Abtretung von zukünftigen Ansprüchen. Mehr dazu hier.
unbewegliches (=immobiles) Vermögen
Die Sicherung mit unbeweglichem Vermögen kann mittels einer Hypothek nach §1113 BGB erfolgen. Dieses Mittel ist akzessorisch und wird in der Praxis kaum verwendet. Abgelöst wurde es durch die Grundschuld nach §1191 BGB. Die Grundschuld ist nicht akzessorisch.