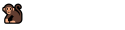Formen der Übereignung
Relatives und absolutes Recht
Relatives Recht kommt beispielsweise durch einen Vertrag zustande. Relatives Recht gilt nur zwischen den Vertragsparteien (Ausnahme: Schutzwirkungen für Dritte). Absolutes Recht hingegen gilt gegen jedermann. Das trifft auf Eigentum zu. Eigentum ist unter anderem durch §985 BGB geschützt. Mit §985 hat der Eigentümer einer Sache gegenüber dem Besitzer einen Herausgabeanspruch. Auch mit §1004 ist Eigentum besonders geschützt: Der Eigentümer hat ein Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch bei einer Beeinträchtigung seiner Sache durch einen Störer.
Übereignung durch §§929ff.
Nach §929 1 BGB wird man Eigentümer einer Sache, wenn 3 Voraussetzungen erfüllt sind. Es muss ein Realakt stattfinden, die Übergabe der Sache, und es muss eine Einigung darüber geben, dass die Sache nun übereignet wurde. Die Einigung ist ein Vertrag. Allerdings muss der Veräußerer auch berechtigt sein, die Sache zu übereignen (dazu weiter unten mehr).
Wenn die Sache schon im Besitz des Erwerbers ist, dann ist nach §929 2 BGB keine Übergabe mehr notwendig. Damit fehlen nur noch Einigung und Berechtigung.
Auch mit §930 BGB wird die Übergabe umgangen. Man will, dass jemand anderes der neue Eigentümer ist, allerdings soll der alte Eigentümer weiterhin der unmittelbare Besitzer sein. Es handelt sich um das Besitzkonstitut. Voraussetzung für dieses Besitzmittlungsverhältnis sind auch die Berechtigung und die Einigung, dass der Erwerber mittelbarer Besitzer wird. Mit dieser Regelung kann man das Pfandrecht umgehen, bei dem eine Übergabe zwingend notwendig ist (§1204 BGB). Das wäre nämlich unpraktisch und realitätsfern bei Sicherungseigentum, wenn also die Bank Produktionseigentum als Sicherheit übergeben bekommen würde.
Mit §931 BGB wird ebenfalls die Übergabe, also der Realakt, umgangen. Hier besteht bereits ein Besitzmittlungsverhältnis zwischen dem Veräußerer und einem unmittelbaren Besitzer. Dem Erwerber wird nicht die Sache übergeben, sondern er erhält den Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers aus §985.
Bei allen diesen Varianten der Übereignung ist die Berechtigung oder gutgläubiger Erwerb eine Voraussetzung.
Gutgläubiger Erwerb
Obwohl das deutsche Recht sehr verwandt mit dem römischen Recht ist, ist der gutgläubige Erwerb eine neue Konstruktion, die nicht im römischen Recht zu finden ist. Im römischen Recht galt, dass man nur Rechte veräußern oder abgeben kann, die man selbst besitzt. Niemand kann mehr Rechte abgeben, als er hat. Für den Vertrauens- und Verkehrsschutz gibt es in Deutschland den gutgläubigen Erwerb.
Für die §§929-931 BGB gelten die §§932-934 im Bezug auf den gutgläubigen Erwerb. Voraussetzung für die Übereignung ist unter anderem die Berechtigung. Berechtigt ist der Eigentümer und ein Besitzer mit der Einwilligung des Eigentümers. Alternativ gibt es diesen gutgläubigen Erwerb. Wenn der Veräußerer nicht berechtigt ist, gilt eine Übereignung, wenn der Erwerb im guten Glauben an die Berechtigung stattfindet. Grobe Fahrlässigkeit darf hier nicht vorliegen. Sie läge vor, wenn der Erwerber beim Kauf eines KFZ den Fahrzeugbrief nicht verlangen würde. Nach §935 BGB ist gutgläubiger Erwerb in jedem Fall ausgeschlossen, wenn es sich um Hehlerware handelt.
Übereignung von Grundstücken
Bei der Übereignung von Grundstücken bedarf es einer Einigung (Auflassung, §925). Dazu wird die Übergabe ersetzt durch die Eintragung im Grundbuch (§873). Nach §892 bedarf es auch einer Berechtigung, außer bei gutgläubigem Erwerb.
Gesetzlicher Eigentumserwerb
Nach §950 BGB erwirbt man Eigentum an einer Sache, wenn man sie verarbeitet und diese Sache dann an Wert gewinnt. Dabei verliert der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum. Für diesen Rechtsverlust ist er zu nach §951 BGB entschädigen. Der ursprüngliche Eigentümer hat auch keinen Anspruch auf Rücknahme der Änderungen.
§950 BGB:
Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.
Mit dem Erwerb des Eigentums an der neuen Sache erlöschen die an dem Stoffe bestehenden
Zum Tragen kommt das beim Verkauf von Roh- und Hilfsstoffen, wie Metallen, die weiterverarbeitet werden zu Maschinen. Wenn zur Absicherung der Kaufpreiszahlung ein Eigentumsvorbehalt besteht, also das Eigentum erst übergeht, wenn bezahlt ist, dann wird diese Sicherung nutzlos bei der Verarbeitung. Bei der Verarbeitung geht trotz Eigentumsvorbehalt das Eigentum über - per Gesetz.
In der realen Welt sind die Unternehmen sich dieser Tatsache bewusst und schaffen einen verlängerten Eigentumsvorbehalt. Zukünftige Ansprüche aus den Erlösen der fertigen Maschinen werden vorher schon abgetreten.