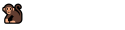Epikur/Schopenhauer: Ist der Tod ein Übel?
Das Thema der vorliegenden Arbeit erscheint im Alltag nicht sonderlich relevant. Man spricht täglich vom Tod, von überfahrenen Katzen oder von sterbenden Menschen an fernen Orten, übermittelt (und damit mittelbar) durch Medien. Der Tod ist präsent, doch er bleibt zumeist abstrakt. Und so kann man abstrakt bleibend leicht sich und anderen Menschen sagen, wie wenig der Tod etwas sei, das gefürchtet werden muss. Mit großer Leichtigkeit kann man man dann noch Bibelstellen über ein negatives postmortales Dasein1 für Märchen erklären. Doch eines Tages kommt wohl jeder Mensch an den Punkt, an dem er sich mit dem Tod konkret auseinandersetzen muss, wenn er nämlich unmittelbar betroffen ist, wie etwa der Protagonist aus Die Schopenhauer-Kur, Julius Hertzfeldt, der als Psychoanalytiker immer alle Antworten den Tod betreffend hatte, bis er selbst tödliche Diagnose erhielt und unsicher wurde.2
Die in Fragen des Todes auftretende Unsicherheit und Betroffenheit der Menschen machen Epikurs Anliegen, zu zeigen, dass der Tod kein Übel sei, zu einem noblen Versuch: Er möchte zur Seelenruhe beitragen. Menschen sollen entspannt auf den Tod blicken, da mit dem Ende des Lebens jede Möglichkeit von Schmerz oder anderen unangenehmen Gefühlen erlöschen würde.
Arthur Schopenhauers Projekt ist es dagegen weniger, zu zeigen, dass der Tod kein Übel sei, sondern vielmehr, die Aufmerksamkeit auf die Übel des Lebens und auf den einen Grund dafür zu lenken. Damit macht Schopenhauer allerdings auch ganz offen klar, dass und warum für ihn der Tod kein Übel ist, wobei er zu dieser Ansicht auch erst im höheren Alter gelang.3
Diese Arbeit hat sich zum Objekt der Untersuchung in dieser Frage die Autoren Epikur und Arthur Schopenhauer gesucht, da sie in einer spannenden Beziehung zueinanderstehen. Es trennen sie mehr als 2.000 Jahre und unterschiedliche metaphysische Annahmen und doch haben sie in wenigstens zwei Fragen ähnliche, wenn nicht gar sehr ähnliche Antworten. Epikur definiert Glück bzw. Freude negativ4 und auch Schopenhauer meint: „Alle Befriedigung, oder was man gemeinhin Glück nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur NEGATIV und durchaus nie positiv“ (WI 415). Und so scheinen sie beide auch den Tod wenig negativ zu sehen.
Diese Arbeit will nun zeigen, wie diese beide Philosophen für die These, dass der Tod kein Übel sei, argumentieren. Dabei soll ersichtlich werden, wie gültig und schlüssig die Argumente sind, welche Prämissen sie haben und vor allem, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es bei den Argumenten und Auffassungen es zwischen Epikur und Schopenhauer gibt.
Inhalt
Begriffliches
Tod
Die Frage, ob der Tod für uns ein Übel sei, muss hinsichtlich der beiden Begriffe „Tod“ und „Übel“ zunächst genauer bestimmt werden. Geschieht das nicht, kann es sein, dass auf eine Frage, wie sie im zeitgeschichtlichen Kontext dieser Arbeit gestellt und verstanden wird, unbeantwortet bleibt. Diese Arbeit ist keine geschichtswissenschaftliche Arbeit und stellt damit aus heutiger Perspektive eine Frage, die hinreichend klar sein muss, um anhand dieser eine Klärung möglicher Argumente von Philosophen aus verschiedenen Epochen zu bewirken.
In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Tod ein Zustand und nicht etwa ein Zeitpunkt (etwa der Todeszeitpunkt) ist: Ein Mensch ist tot, wenn sein Organismus als Ganzes, als funktionale Einheit, unwiderruflich gestorben sind und die Organe nicht mehr dazu beitragen, das Lebewesen als eigenständiges Ganzes zu erhalten. Damit folgt diese Arbeit der funktionalen, naturalistischen Todesauffassung.5
In ihren Argumenten müssen Epikur und Schopenhauer also zur Beantwortung der Frage dieser Arbeit eine Antwort liefern in Bezug auf den Zustand, der nach dem körperlichen Ende eines Menschen eintritt.
Neben diesem fixen Punkt gibt es noch einigen Spielraum: Schränkt man diese Definition ein auf das Leben des Körpers, so bleiben dennoch zwei Optionen, die zu klären sind. Wie das Oxford Dictionary of Philosophy schreibt, kann der Tod entweder „the cessation of life“ sein, also das Ende des Lebens eines Individuums, oder aber er ist nur das körperliche Ende, womit als zweite Option die Unsterblichkeit der Seele als eigenständig lebender Teil bleibt.6
Wie Epikur und Schopenhauer den Zustand des Todes in ihren philosophischen Systemen einordnen oder erklären, wird zentral sein für ihre Argumentation dafür, dass der Tod kein Übel für den Sterbenden7 sei.
Übel
Auch in Bezug auf den Begriff „Übel“ braucht es einen festen Ausgangspunkt. Eine Arbeitsdefinition oder Referenzbegriff ist auch hier notwendig, da die Frage, ob der Tod ein Übel sei, nicht bloß auf eine Art verstanden werden kann.8
Während die Auffassungen vom Tod bei beiden Philosophen von der oben implizit präferierten materiell-monistischen Betrachtung abweichen können, solange unter „Tod“ der Zustand nach dem körperlichen Ende eines Lebewesen verstanden wird, muss der Begriff „Übel“ noch etwas enger gefasst werden.
Die Perspektive ist noch zu klären: Es geht darum, ob der eigene Tod für uns selbst ein Übel sein wird, wenn er eintritt. Es geht nicht darum, ob der eigene Tod ein Übel für den Sterbenden ist, bevor er tot ist; auch geht es nicht darum, ob der Tod anderer Menschen ein Übel für noch Lebende ist.
In diesem Sinne geht es in dieser Arbeit also nicht um ein qualvolles Leben oder qualvolles Sterben (wobei in dieser Arbeit zwischen beiden kein Unterschied gemacht wird), sondern um das Todsein und darum, ob dieser Zustand ein Übel, im Sinne von Leid und nicht im Sinne von Moral, ist.
Epikur
Argumente
Epikurs Philosophie, die zu Unrecht immer wieder mit dem Hedonismus in Verbindung gebracht wird,9 hatte den Zweck, Menschen vom Leiden zu befreien.10 Menschen sollten befreit werden von allen körperlichen Schmerzen und auch seelischen Leiden. Ängste gehören zu den letzteren. Und so macht Epikur die Ängste aus, die Menschen (wenigstens seinerzeit) am meisten bedrücken: Götter, Schmerzen und der Tod. Nachfolgend geht es nun um die letzte dieser Ängste, und warum sie laut Epikur unbegründet ist.
Als Quellen für Epikurs bekanntes Argument, dass der Tod kein Übel für uns sei, sind die Briefe an Herodotos und an Menoikeus die bedeutendsten. Insbesondere der Brief an Menoikeus enthält eine elaboriertere Variante dieses Arguments. Zunächst jedoch aus dem Brief an Herodotos:
„Die Beunruhigung wird weiter durch die von den Mythen erregte ängstliche Erwartung ewiger Schrecken genährt und auch durch die Furcht vor der mit dem Tode eintretenden Empfindungslosigkeit, als ob sie diese dann noch etwas anginge.“11
Sicher, dieser Satz beinhaltet weder „also“ noch „dann“ oder ähnliche Wörter, die auf ein Argument schließen lassen, jedoch lässt sich hier ein Argument rekonstruieren. Dass Marker bzw. Signalwörter oder Prämissen fehlen, ist nicht unüblich, sondern macht eine Argumentrekonstruktion bloß umso notwendiger.
In diesem Satz wird als Volksmeinung präsentiert, dass mit dem Tod zwei Übel eintreten: ewige Schrecken und eine Empfindungslosigkeit. Implizit antwortet Epikur darauf, dass mittels der Empfindungslosigkeit für den Toten kein Übel mehr möglich sei. Das Argument sollte so rekonstruierbar sein:
-
Ein Übel muss notwendigerweise empfindbar sein.
-
Der Zustand des Todes bringt notwendig die Empfindungslosigkeit mit sich.
-
Also: Der Zustand des Todes ist frei von Übeln.
Formalisiert:
-
ü → e
-
t → ¬ e
-
Also: t → ¬ ü
Bedeutender als dieses Argument im Brief an Herodotos ist allerdings das Argument im Brief an Menoikeus:12
„Gewöhne dich an den grundlegenden Gedanken, daß der Tod für uns ein Nichts ist. Denn alles Gute und alles Schlimme beruht darauf, daß wir es empfinden. Verlust aber dieser Empfindung ist der Tod. Deshalb macht die rechte Erkenntnis, daß der Tod für uns ein Nichts ist, die Sterblichkeit zu einer Freude; sie fügt nicht nach dem Tode eine grenzenlose Zeit hinzu, sondern tilgt in uns die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit. Für den, der recht begriffen hat, daß es im Nichtleben nichts Schreckliches gibt, für den gibt es ja auch im Leben nichts Schreckliches. Daher ist ein Tor, wer da erklärt, er fürchte den Tod nicht, weil er Leid zufügen werde, wenn er da sei, sondern weil er Leid zufüge, da er bevorstehe. Es ist unsinnig zu glauben, was nicht beunruhige, wenn es da sei, werde Leid zufügen, weil es zu erwarten sei. So ist also der Tod, das schauervollste Übel, für uns ein Nichts; wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden noch die Gestorbenen an; für die einen ist er ja nicht vorhanden, die andern aber sind für ihn nicht mehr vorhanden.“13
Epikur „wiederholt“14 zunächst das bereits bekannte Argument:
„Gewöhne dich an den grundlegenden Gedanken, daß der Tod für uns ein Nichts ist. Denn alles Gute und alles Schlimme beruht darauf, daß wir es empfinden. Verlust aber dieser Empfindung ist der Tod.“
Daraus schließt er nun, dass der Tod uns ein „Nichts ist“, aber auch weitere Konsequenzen für die Perspektive des Lebenden, die für die Frage dieser Arbeit nicht relevant sind. Schließlich zieht Epikur seine prominente Konklusion: „wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“ Auch diese Konklusion ist nur in Teilen relevant für die Perspektive, mit der die vorliegende Arbeit die Frage, ob der Tod ein Übel sei, beantworten will.
Substanziell bleibt Epikurs Argument aus dem hier zuerst zitierten Brief bestehen, wenn auch der Brief an Menoikeus das erste Argument verdeutlicht, ausschmückt und die Interpretation stützt.
Voraussetzungen und Plausibilität
Die beiden hauptsächlichen Voraussetzungen Epikurs lassen sich in beiden Prämissen des vorgestellten Arguments ablesen:
Dass der Tod kein Übel ist (t → ¬ ü) wird begründet durch eine sensualistische Definition von „Übel“, nämlich als Empfindung, (ü → e) und eine materialistischen Überzeugung, dass der Tod das Ende aller Empfindungen sei (t → ¬ e).
Epikur geht also erstens davon aus, dass alles Gute und Schlechte nur insofern für einen Menschen existiert, solange es wahrnehmbar ist.15 Wenn man um ein Übel nicht weiß, weil man keinerlei Empfindungen dahingehend hat, so ist es kein Übel. Wenn es ein Übel, oder irgendetwas Schlechtes für einen Menschen gibt, dann muss es davon eine Empfindung geben:
-
(¬ e → ¬ ü)
-
(ü → e)
Ist das plausibel? Bekanntlich versteht Epikur unter Freude, keine körperlichen Schmerzen zu erleiden und in der Seele Frieden zu haben.16 Daher ist es ihm wichtiger, Übel zu vermeiden als Freuden zu suchen. Vermeidet man Schmerzen, ist die Höchstgrenze an Freude erreicht.17 Es heißt bei Epikur auch:
„Keine Freude ist an sich ein Übel; doch das, was gewisse Freuden erzeugt, bringt vielerlei Beschwerden mit sich, die die Freuden um ein Vielfaches übersteigen.“18
Angenommen, man verzehrt Süßwaren und empfindet dabei eine große Freude, wenigstens ist man schmerzfrei körperlich wie psychisch. Warum sollte man aufhören zu essen, und, wie Epikur meint,19 Brot und Wasser bevorzugen? Es ist sicher eine Klugheitsregel, wenig Süßes zu essen, um den üblen Folgen übermäßigen Zuckerkonsums zu entgehen, doch ein Übel dürfte man mit Epikur die Süßwaren nie nennen. Überhaupt scheint es bei ihm unmöglich das Prädikat „übel“ auf irgendwas anzuwenden, das bloß negative Folgen hat.
Auch ist es bei Epikur anscheinend kein Übel, wenn einem Menschen geschadet wird, aber der Schaden nicht wahrnehmbar ist. Umgekehrt passiert einem Menschen nichts Gutes, außer er nimmt es wahr – und nur während der Wahrnehmung ist es gut.
Vielleicht erlaubt die Übersetzung aus dem Altgriechischen es nicht, mittels unseren Sprachgebrauchs die Plausibilität dieser epikureischen Gedanken anzuzweifeln. In jedem Fall scheint es jedoch konsistent zu sein: In dem Moment, in dem man Angst vor dem Tod hat, erleidet man nicht den Tod, aber die Übel der Angst vor dem Tod. Wird diese durch das Philosophieren behoben, weil man sich an den Gedanken gewöhnt, dass der Tod selbst mangels Wahrnehmungsfähigkeit für den Toten selbst kein Übel sein kann, so verschwindet auch die Angst.
Unser Sprachgebrauch ist es auch, der dieses Argument Epikurs merkwürdig oder unplausibel erscheinen lässt: Wenn man heutzutage jemandem eine Handlung oder einen Umstand übel nimmt, so muss man nicht zwangsläufig leiden. Das Wort „Übel“ wird eben auch moralisch verwendet.
Zweitens liegt bei Epikur der Atomismus als zentrale Prämisse vor. Epikur erklärt Wind, Wetter und Weltgeschehen materialistisch. Alles besteht bei ihm aus Atomen, die miteinander interagieren, sich verbinden oder auseinanderfallen. In der Tradition Demokrits erklärt Epikur auch die Seele atomistisch-materialistisch. Dabei ist er keineswegs ein Dualist, sondern bleibt ein materialistischer Monist, bei dem der materielle Tod des Körpers mit dem materiellen Tod der Seele einhergeht. Der Tod eines Menschen wird ein simpler mechanischer und natürlicher Vorgang in der Welt.20
Mit dieser Prämisse hört die Seele als Epikurs Wahrnehmungsorgan auf zu existieren, sobald der Tod eintritt.
Schopenhauer
Ziel
Das Ziel Schopenhauers mag völlig anders erscheinen als das Epikurs, insbesondere, wenn man sein metaphysisches Konstrukt des „Willens“ und seine vermeintliche Misanthropie21 denkt. Doch folgt man den Recherchen von Rüdiger Safranski, die ihn in dem handschriftlichen Nachlass Schopenhauers durch die Entstehungsgeschichte von Schopenhauers philosophischen System geführt haben, so ging es auch bei Arthur Schopenhauer zunächst um die Befreiung vom Leid:
„Zuerst erlebte Schopenhauer den ‚Willen‘ als dasjenige, woran er leidet und wovon er sich befreien will, und dann erkennt er den Willen als das ‚Ding an sich‘, als jene universelle Wirklichkeit, die allen Erscheinungen zugrunde liegen soll.“22
Die größte Bedeutung hat auch in Schopenhauers Werken die Befreiung von Leiden. Und die Befreiung von Leid schlechthin ist nach Schopenhauer der Tod. Nachfolgend geht es nun um seine Argumente dafür, dass der Tod frei von Leid bzw. Übeln sei, und um seine Antworten auf Todesfurcht.
Vielfach beschäftigt sich Schopenhauer mit der Todesfurcht,23 doch geht es in dieser Arbeit nicht um – mit Epikur gesprochen – das Übel der Furcht vor dem Tod, sondern um ein mögliches Übel des Totseins. Ob das wiederum Auswirkungen auf die Todesfurcht des Lebenden/Sterbenden hat, ist eine ganz andere Frage.
Nach dem Leben ist vor dem Leben
Im 41. Kapitel des zweiten Bandes von Die Welt als Wille und Vorstellung liefert Schopenhauer das Argument, dass der Tod ein Nichtsein ist, welches mit dem vor der Geburt zu vergleichen sei. Und so soll feststehen, dass kein Übel im Totsein existiert:
„Wenn was uns den Tod so schrecklich erscheinen läßt der Gedanke des NICHTSEYNS wäre; so müßten wir mit gleichem Schauder der Zeit gedenken, da wir noch nicht waren, Denn es ist unumstößlich gewiß, daß das Nichtseyn nach dem Tode nicht verschieden seyn kann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerther. Eine ganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir NOCH NICHT waren: aber das betrübt uns keineswegs.“ (WII 540f.)
Das Argument lautet also so:
-
Die Zeit nach dem letzten Atemzug gleich der Zeit vor der Empfängnis.
-
Wenn die Zeit vor der Empfängnis ein Übel wäre, so hätten wir eine Erinnerung daran.
-
Wir haben keine Erinnerungen an eine Zeit vor der Empfängnis.
-
Also ist die Zeit vor der Empfängnis kein Übel.
-
Also ist die Zeit nach dem letzten Atemzug kein Übel.
In dieser Rekonstruktion ist der „Tod“ ersetzt worden durch „die Zeit nach dem letzten Atemzug“, da im allgemeinen Sprachgebrauch mit „Tod“ sowohl ein Zeitpunkt (des Todes) als auch das Totsein gemeint ist. Die Zeit vor der Geburt wurde nun wohlwollend sicherheitshalber interpretiert als die Zeit vor der Empfängnis, da es sinnvoll sein kann, davon zu sprechen, dass schon vor der Geburt ein Mensch, ein fühlendes Wesen, existiert und Schopenhauer hier eher als unpräzise angesehen werden sollte.
Die erste Prämisse ist aus heutiger, „westlicher“ Sicht einigermaßen unkritisch, ebenso wohl die dritte Prämisse. Dagegen ist die zweite sehr fragwürdig: Gibt es denn auch im Leben keine vergangenen Übel, die vergessen, oder verdrängt werden? Wenn schon im Leben Schlechtes verdrängt wird, so dürfte es absolut nicht verwundern, dass pränatale Leiden (oder gar Leiden vor der Empfängnis) verdrängt werden. Denn wie schreibt Schopenhauer selbst, dass die Leiden des Lebens Menschen in den Tod drängen können, und daher von größerem Ausmaß sein müssten:
„Nun ist es aber sogleich sehr bemerkenswerth, daß einerseits die Leiden und Quaalen des Lebens leicht so anwachsen können, daß selbst der Tod, in der Flucht vor welchem das ganze Leben besteht, wünschenswerth wird und man freiwillig zu ihm eilt; [...]“ (WI 408)
Die schopenhauerschen Passagen, die wahrscheinlich für Freuds Konzept der Verdrängung die Basis waren,24 lassen sich hier gegen die zweite Prämisse in Stellung bringen. Wenn Menschen Erinnerungen nicht bloß einfach vergessen, sondern auch verdrängen können, kann es selbstverständlich vor der Empfängnis Übel geben, und so der ersten Prämisse nach auch im Tod.
Über diesen ersten Einwand, den man aus Schopenhauers Werk entnehmen kann, liefert er gegen diese zweite Prämisse noch einen weiteren Einwand:
„Der Selbstmord kann auch angesehn werden als ein Experiment, eine Frage, die man der Natur stellt und die Antwort darauf erzwingen will: nämlich, welche Aenderung das Daseyn und die Erkenntniß des Menschen durch den Tod erfahre. Aber es ist ein ungeschicktes: denn es hebt die Identität des Bewußtseyns, welches die Antwort zu vernehmen hätte, auf.“ (PII 277)
Mit der ersten Prämisse dürfte also auch keine Identität des Bewusstseins zwischen „dem Menschen“ vor der Empfängnis und dem postnatalen Menschen bestehen. Die Übel vor der Empfängnis, die es zu vernehmen gäbe, könnten daher nicht im Bewusstsein des postnatalen Menschen vorhanden sein.
Wurde die zweite Prämisse vielleicht falsch rekonstruiert? Schopenhauer schreibt: „Eine ganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir NOCH NICHT waren: aber das betrübt uns keineswegs.“ Wie sollte uns die Zeit vor der Empfängnis betrüben, wenn nicht durch Erinnerung? Generell betrübt doch nur die Angst vor der ungewissen Zukunft und die Erinnerung an die bekannte Vergangenheit, falls uns unser Gedächtnis oder mögliche Irrationalitäten einem keinen Streich spielen. Pränatales liegt zwangsläufig in der Vergangenheit und diese kann daher nur betrüben, wenn es Erinnerungen gibt. Eine falsche Rekonstruktion dieser Prämisse scheint somit wenig plausibel – ebenso wie das ganze hier vorgestellte Argument Schopenhauers.
Allerdings ist dieses „Nach dem Leben ist wie vor dem Leben“-Argument nicht ausreichend, um Schopenhauers Position zu verstehen. Zwar stimmt diese Gleichung gewissermaßen mit Schopenhauers Ansichten überein, aber dieses hier vorgestellte Argument ist lediglich ein Einwand Schopenhauers gegen die Todesfurcht. Sein philosophisches System liefert ihm ein anderes Argument, womit er ganz offensichtlich einen anderen Weg als Epikur einschlägt.
Kein Bewusstsein im Tod
Während Epikur und der o.g. Einwand Schopenhauers den Weg der postmortales Nichtexistenz einschlagen, könnte man das folgende Argument zunächst als ein weniger voraussetzungsreiches, und dadurch vielleicht besseres Argument verstehen: Nicht die Nichtexistenz nach dem letzten Atemzug wird proklamiert, sondern lediglich das Fehlen eines Bewusstseins, wie bereits oben aus dem zweiten Band der Parerga und Paralimpomena zitiert wurde.
Der Schlüssel zum Verständnis Schopenhauers, warum der Tod bzw. das Totsein kein Übel sein kann, liegt allerdings in seinem metaphysischen System.
Das „Ding an sich“, das Kant der Nachwelt 1804 hinterließ, brachte auch die Phantasie Schopenhauers zum Aufblühen, der hinter allen Erscheinungen den einen Willen sieht. Zunächst übernahm Arthur Schopenhauer eine Perspektive, die er von Kant gelernt hatte, und die Kants noch ähnlich war: Unser erkenntnistheoretischer Zugang zur Welt ist nicht mehr als ein Zugang zu der Welt als Erscheinung, als Vorstellung. Was die Dinge in der Welt an sich sind, können wir nicht wissen, nur, wie sie uns mittels unserer Sinne und dem Verstand erscheinen. Da man selbst aber auf den eigenen Körper zwei Perspektiven habe, nämlich nicht nur von außen als Erscheinung, sondern hier auch „hinter die Fassade“ blicken könne und von innen die Willensakte erlebe, gäbe es ein Objekt in der Welt, zu dessen „an sich“ wir einen Zugang haben würden:
„mein Leib und mein Wille sind Eines; – oder was ich als anschauliche Vorstellung meinen Leib nenne, nenne ich, sofern ich desselben auf eine ganz verschiedene, keiner andern zu vergleichende Weise mir bewußt bin, meinen Willen; – oder, mein Leib ist die OBJEKTITÄT meines Willens; – oder, abgesehen davon, daß mein Leib meine Vorstellung ist, ist er nur noch mein Wille; u.s.w.“ (WI, 154f.)
Mittels Analogieschluss sind Schopenhauer alle Dinge der empirischen Welt Erscheinungen mit individuellen, empirisch wahrnehmbaren Willen (WI 156f.). „An sich“ sind alle Objektivationen des einen Willen, da, so Schopenhauer, Raum und Zeit „bloß“ Vorstellungen sind (D 41), und es somit weder ein Nach- noch ein Nebeneinander (D 42) gibt und keine Vielheit (principium individuationis). Der Wille ist in allen Erscheinungen der raumzeitlichen Welt individuiert:
„Erst nachdem das innere Wesen der Natur (der Wille zum Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche der bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüstig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei. Seine Verwunderung ist aber um so ernstlicher, als es hier zum ersten Male mit Bewußtsein DEM TODE gegenübersteht, und neben der Endlichkeit alles Daseyns auch die Vergeblichkeit alles Strebens sich ihm mehr oder minder aufdringt. Mit dieser Besinnung und dieser Verwunderung entsteht das dem Menschen allein eigene BEDÜRFNISS EINER METAPHYSIK […]“ (WII 184f.)
Wie argumentiert Schopenhauer in diesem System dafür, dass der Tod für den Toten, bzw. den, der dann gestorben sein wird, kein Übel sei? Schopenhauer schreibt dazu:
„Man kann demnach jeden Menschen aus zwei entgegengesetzten Gesichtspunkten betrachten: aus dem einen ist er das zeitlich anfangende und endende, flüchtig vorübereilende Individuum, […] dazu mit Fehlern und Schmerzen schwer behaftet; – aus dem andern ist er das unzerstörbare Urwesen, welches in allem Daseyenden sich objektivirt […]. Freilich könnte ein solches Wesen etwas Besseres thun, als in einer Welt, wie diese ist, sich darzustellen. Denn es ist die Welt der Endlichkeit, des Leidens und des Todes.“ (PII 253)
Ein Mensch ist im System Schopenhauers also sowohl Erscheinung als auch das „Urwesen“, der „Urwille“. Wenn Schopenhauer also schreibt, dass mit Eintreten des Todes die Identität des Bewusstseins aufgehoben wird (PII 277), dann ist „die Welt der Endlichkeit, des Leidens und des Todes“ verlassen. Dann ist der Mensch nicht mehr eine Objektivation, er ist dann kein Individuum mehr. Was dann mit dem Tod ins Nichts übergeht und hervorgeht aus dem Nichts (PII 251) ist das Bewusstsein. Dieses nämlich, so Schopenhauer, hänge nicht am Willen, sondern am Intellekt, dessen Funktion es sei (PII 249f.). Damit wird auch klar, wieso sich nicht der „Urwille“, sondern erst die Entität, das Lebewesen mit dem größten Intellekt, also der Mensch, Fragen nach dem Tod stellt: Der Wille wird sich seiner selbst bewusst (WII 184f.).
Wie stellt sich Schopenhauers Argument dar? Warum ist der Tod kein Übel für den Toten?
-
Es gibt kein Übel ohne ein Bewusstsein.
-
Nach dem letzten Atemzug hört das Bewusstsein auf zu existieren.
-
Also gibt es nach dem letzten Atemzug kein Übel.
Diese stark vereinfachte Struktur ist nun unser Ausgangspunkt. Mit der ersten Prämisse ist man wieder einmal nicht fern von Epikur, was auch an dieser Rekonstruktion liegt. Näher am Text Schopenhauers hätte man aus PII 253 „Leiden“ schreiben können. Darüber hinaus schreibt Epikur „empfinden“ und nicht „Bewusstsein“. Da beide Begriffe als Voraussetzungen für Übel die gleiche Deutung von „Übel“ fordern und sprachliche Differenzen durch über 2.000 Jahre Differenz begründet sind, ist der Unterschied zwischen Epikur und Schopenhauer an dieser Stelle gering. Übel sind hier bloß die erlebten Leiden.
Die Ähnlichkeit zwischen Epikur und Schopenhauer ist an dieser Stelle nicht bloß von außen als eine solche zu bewerten, sondern auch Schopenhauer sieht diese und lobt sodann auch Epikur:
„Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtete EPIKUR den Tod und sagte daher ganz richtig [...] (der Tod geht uns nichts an); […] im Erkennen aber besteht das Bewußtseyn; daher für dieses der Tod kein Uebel ist.“ (WII 542)
Das Problem oder die Herausforderung ist in diesem Argument die zweite Prämisse. In unserem heutigen Kulturkreis fällt die Zustimmung zu dieser Prämisse zwar nicht schwer, aber für Schopenhauer steckt dahinter kein Materialismus, zu dem man heute geneigt ist, und der Epikur zugeschrieben wird. Schopenhauers Stütze für diese Prämisse ist seine aus Kant entwickelte Unterscheidung zwischen Erscheinung und dem „Ding an sich“, welches er mit seinem „Willen“ gefüllt hat. Fragt man gemäß Schopenhauers „zweiten Klasse der Objekte für das Subjekt und die in ihr herrschende Gestaltung des Satzes vom zureichenden Grunde“ (D 106 ff.) nach dem „Warum“ hinter der o.g. zweiten Prämisse, dann sollte die folgende Rekonstruktion die Gedanken Schopenhauers richtig einordnen und dabei uns weniger akzeptabel erscheinen lassen.
-
Bewusstsein gibt es nur, wenn der Wille als Mensch objektiviert ist.
-
Nach dem letzten Atemzug ist der Mensch keine Objektivation mehr.
-
Also hört nach dem letzten Atemzug das Bewusstsein auf zu existieren.
Wie Schopenhauer in seiner Dissertation schrieb, findet die Reihe der Erkenntnisgründe, die Reihe der Urteile, die jeweils logische Wahrheit verleihen, im Gegensatz zur Reihe von Kausalitäten, immer ein Ende (D 163),25 obwohl man weiter „Warum“ fragen kann. Hier ist es nun noch sinnvoll, nach dem Grund bzw. den Prämissen hinter dem Schluss zu fragen, der sich hinter dieser ersten Prämisse verbirgt. Wie nämlich bereits dargestellt, hat Schopenhauer dafür sein ganzes System. Im Rahmen dieser Arbeit ist es allerdings nicht zu leisten, die Konsistenz dieses Systems im Einzelnen zu untersuchen und darzustellen – zudem würde es von der Fragestellung dieser Arbeit wegführen. Zur Plausibilität dieses Arguments in Anbetracht seines metaphysischen Systems daher nachfolgend einige zentrale Kritikpunkte an diesem Argument:
Der Schopenhauer-Schüler Philipp Mainländer steht – vereinfacht gesagt – in dieser Frage deutlich näher an Epikur und kritisiert einen Teil des metaphysischen Apparats von Schopenhauer erkenntnistheoretisch:
„[Schopenhauer] nimmt die Miene an, als ob er ganz genau, aus sicherster Quelle, erfahren habe, was mit einem Selbstmörder nach dem Tode vorgehe. Die Wahrheit ist, daß der Selbstmörder, als Ding an sich, im Tode vernichtet wird, wie jeder Organismus. Lebt er nicht in einem anderen Leibe fort, so ist der Tod seine absolute Vernichtung […]“26
Doch Kritik an der Metaphysik Schopenhauers müsste sich Mainländer ebenso gefallen lassen, da er im Grundsatz Schopenhauers Willensmetaphysik übernimmt.
Interessanter und näher an Epikur ist jedoch die Frage nach dem Materialismus. Schopenhauers System steht schon in der Dissertation im ungeklärten Spannungsfeld zwischen Idealismus und Materialismus. So meint er:
„Demnach hat der Verstand die objektive Welt erst selbst zu schaffen: nicht aber kann sie, schon vorher fertig, durch die Sinne und Oeffnungen ihrer Organe, bloß in den Kopf hineinspazieren.“ (D 65)
Und zugleich:
„Erst wenn der VERSTAND, – eine Funktion, nicht einzelner zarter Nervenenden, sondern des so künstlich und räthselhaft gebauten, drei bis gegen fünf Pfund wiegenden Gehirns, – in Thätigkeit geräth und seine einzige und alleinige Form, DAS GESETZ DER KAUSALITÄT, in Anwendung bringt, geht eine mächtige Verwandlung vor, indem aus der subjektiven Empfindung die objektive Anschauung wird. […] Zugleich nimmt er die ebenfalls im Intellekt, d.i. im Gehirn, prädisponirt liegende Form des ÄUSSERN Sinnes zu Hülfe, den RAUM [...]“ (D 65)
So schreibt dann auch Martin Morgenstern:
„Ähnlich wie das Gehirnparadox, wonach das Gehirn einerseits Teil und andererseits Produzent der Welt als Vorstellung ist, ergibt sich auch die zirkuläre Struktur der Theorie der Anschauung dadurch, dass Schopenhauer transzendental-idealistische und realistisch-materialistische Betrachtungen miteinander verbindet und beide merkwürdigerweise für vereinbar hält.“27
Schopenhauers naturwissenschaftliches Studium in Göttingen, Kant, Platon und seine Entdeckungen aus Indien sind in einem schwierigen Verhältnis zueinander in diesem System verbaut. Dabei eckt er insbesondere am Materialismus immer wieder an, und an dieser Stelle kritisiert er stets Epikur als einen Hauptvertreter:28
„[…] aus diesen konstruirt er die Welt, wie Demokrit, Système de la nature, Epikur. […] Und dies Verfahren des Materialismus bleibt falsch.“29
Gegen Epikur, den er an dieser Stelle nicht explizit nennt, ist auch diese Textstelle, die darüber hinaus gut verdeutlicht, wo Schopenhauers System stehen will und woraus die o.g. Probleme resultieren:
„Nach Allem inzwischen, was über den Tod gelehrt worden, ist nicht zu leugnen, daß, wenigstens in Europa, die Meinung der Menschen, ja oft sogar des selben Individuums, gar häufig von Neuem hin und her schwankt zwischen der Auffassung des Todes als absoluter Vernichtung und der Annahme, daß wir gleichsam mit Haut und Haar unsterblich seien. Beides ist gleich falsch: allein wir haben nicht sowohl eine richtige Mitte zu treffen, als vielmehr den höhern Gesichtspunkt zu gewinnen, von welchem aus solche Ansichten von selbst wegfallen.“ (WII 538)
Letztendlich bietet Arthur Schopenhauer sich und seinen Lesern gerne stets das beste aus beiden Welten, betritt die Mitte, nennt oder begründet sie als einen „höhern Gesichtspunkt“. Damit schafft er wie Safranski meint, eine „Metaphysik ohne Himmel“30 oder auch „Protestantism without Theism“31 nach Beiser.
Fazit
Kontext der Frage dieser Arbeit war das Ziel Epikurs für Seelenruhe zu sorgen. Er wollte Menschen ihre Ängste nehmen und dadurch ihr Leben verbessern. Obgleich der Fokus dieser Arbeit nicht darauf lag, Menschen hinsichtlich ihrer bevorstehenden Tode zu beruhigen, darf und muss wohl festgestellt werden, dass sowohl Epikur als auch Schopenhauer an dieser Stelle als gescheitert betrachtet werden müssen. Die vorliegende Arbeit war – vereinfacht gesagt – eingeschränkt auf die Perspektive des Toten auf seinen Tod. Doch offensichtlich konnten Epikur und Schopenhauer mit Blick auf die Perspektive des Lebenden auf seinen bevorstehenden Tod nicht beruhigen.32 Ein materialistisch-monistisches Weltbild Epikurs beruhigt in dem Sinne die Toten, aber nicht die Lebenden, die nicht wollen, dass ihre Identität irgendwann ruht.33 Auch Schopenhauers System liefert trotz anderer beschrittener metaphysischer Pfade ein Ende der individuellen Persönlichkeit.
Nun zum Hauptanliegen dieser Arbeit: Es wurden drei Argumente vorgestellt. Zum einen Schopenhauers Argument, dass nach dem Ableben nichts kommen kann, was nicht vor dem Leben schon kam; und dass vor dem Leben kein Übel gewesen war. Dieses Argument ist offensichtlich eher schwach, wie auch die Widerlegungen mit Schopenhauers eigenen Überlegungen gezeigt haben.
Die beiden verbleibenden Argumente, je von Epikur und von Schopenhauer, sind, wie Schopenhauer selbst schreibt, einander recht ähnlich. Begriffspaare wie „Leid“/“Übel“ und „Empfindung“/“Bewusstsein“ sollten kein Hindernis sein, diese Argumente als gleich wahrzunehmen. Unterschiedlich ist allerdings ganz klar, wie die Behauptung gestützt wird, dass die „Empfindbarkeit“ oder das “Bewusstsein“ mit dem Todeseintritt erlischt. Epikur hat den „Materialismus“ und Schopenhauer hat seine Willensmetaphysik. Von Epikur ist wenigstens aufgrund der zeitlichen Distanz kein umfangreiches, komplexes philosophisches System überliefert, besonders nicht aus sicherer Quelle. Das ist bei Schopenhauer anders. So lassen sich bei ihm wesentliche Probleme oder sogar Widersprüche im System finden, sodass dieses Argument bei ihm eher schwach gestützt wird.
Sowohl Ockhams Rasiermesser, also die Forderung nach der Sparsamkeit an Voraussetzungen/Hypothesen, als auch unsere heutige, westliche Sichtweise lassen uns Epikur hinsichtlich dieses Arguments wenigstens deutlich näher erscheinen.
Die Interpretation der Fragestellung dieser Arbeit wurde eng gewählt und lässt dadurch vollkommen offen, in welchem Sinn man von dem Tod als einem objektiven Übel sprechen kann. Wäre sie in dieser Hinsicht weiter gewesen, würde die in der Einleitung geforderte Relevanz bzw. Betroffenheit verloren gehen. Der eigene Tod wird eben subjektiv betrachtet.
Einzig eine Ausweitung der Frage auf die Perspektive des Lebenden auf den eigenen Tod wäre in diesem Rahmen eine sinnvolle Erweiterung, in der allerdings noch ausgiebig Begriffe wie „Rationalität“ diskutiert werden sollten. Denn welchen Einfluss hat es oder muss es auf die Gefühlslage (Furcht) haben, dass es ein schlüssiges Argument gegen die Existenz des Gegenstands der Angst gibt?
Zitierweise der Werke Schopenhauers
Normalzitierung34 der von Schopenhauer selbst veröffentlichten Werke erfolgt, falls nicht anders angegeben, nach:35
Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden. Nach den Ausgaben letzter Hand herausgegeben von Ludger Lütkehaus. Frankfurt 2006. [„Lü3“ nach den Seitenkonkordanzen von Schubbe/Koßler]
- G = Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (3. Band)
- F = Ueber das Sehn und die Farben (3. Band)
- W I = Die Welt als Wille und Vorstellung I (1. Band)
- W II = Die Welt als Wille und Vorstellung II (2. Band)
- N = Ueber den Willen in der Natur (3. Band)
- E = Die beiden Grundprobleme der Ethik (3. Band)
- P I = Parerga und Paralipomena I (4. Band)
- Ρ II = Parerga und Paralipomena II (5. Band)
- D = Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (3. Band)
1 Vgl. etwa Markus 9,43-44, Matthäus 22,13, Matthäus 13,42 und Römer 2,8-9. 2 Vgl. Irvin D. Yalom, Die Schopenhauer-Kur, München 2005, S. 7. 3 Das Hauptwerk Schopenhauers von 1818 zeigt eine eher theoretische Behandlung des Todes, während etwa die Paralipomena sich praktischer mit dem Thema beschäftigen und dabei weniger von einer Art „Wiedergeburt“ in die Hölle des Lebens ausgehen, sondern eher von einer endgültigen Ruhe. Vgl. WI, 362; PI 482. 4 Vgl. Paul M. Laskowsky (Hrsg.), Epikur. Philosophie der Freude. Briefe. Hauptlehrsätze. Spruchsammlung. Fragmente. Übertragen und mit einem Nachwort versehen von Paul M. Laskowsky, Frankfurt/Leipzig 1988, S. 58. 5 Vgl. Héctor Wittwer, Philosophie des Todes, Stuttgart 2009, S. 12f. 6 Vgl. „death“, in: Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 2016, S. 120. 7 Mit Schopenhauer (WI, 406) wird hier jeder lebende Mensch als sterbend bezeichnet: „das Leben unseres Leibes nur ein fortlaufend gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tod ist.“ 8 Vgl. Marcus Willaschek, Ist der Tod ein Übel, unveröffentlicht, Frankfurt, S. 1. 9 „Zu Unrecht“, weil Hedonismus mit maßlosem Streben nach (kurzfristigen) Genüssen assoziiert wird, während Epikur lediglich das Ziel der körperlichen und seelischen Schmerzlosigkeit ausgab. 10 Vgl. Héctor Wittwer, Der Tod. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart 2014, S. 56. 11 Paul M. Laskowsky (Hrsg.), Epikur. Philosophie der Freude. Briefe. Hauptlehrsätze. Spruchsammlung. Fragmente. Übertragen und mit einem Nachwort versehen von Paul M. Laskowsky, Frankfurt/Leipzig 1988, S. 33. 12 Es wird beispielsweise von Scherer 1979:109, Willaschek und Wittwer 2009:42 zitiert. 13 Paul M. Laskowsky (Hrsg.), Epikur, S. 54f. 14 Die zeitliche Reihenfolge der Briefe Epikurs ist unbekannt. 15 Vgl. Georg Scherer, Das Problem des Todes in der Philosophie, Darmstadt 1979, S. 109. 16 Paul M. Laskowsky (Hrsg.), Epikur, S. 58. 17 Vgl. ebd., S. 63. 18 Ebd., S. 65. 19 Vgl. ebd., S. 57 f. 20 Vgl. Georg Scherer, Das Problem des Todes, S. 108. 21 Gegen die Misanthropie Schopenhauers spricht die ausgeprägte Mitleidsethik, bspw. WI, 486/488. 22 Rüdiger Safranski, Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie, Frankfurt 2016, S. 299. 23 Vgl. I: 368ff., 407f.; II: 280, 410f., 537ff., 578f., 581f., 708; IV: 128, V: 186, 245, 248. 24 Vgl. Daniel Schubbe / Matthias Koßler (Hg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2018, S. 306; WII Kap. 32, insb. WII 466. 25 Und steht damit bei Agrippa und Hans Albert, vgl. hierzu Martin Morgenstern, Schopenhauers Theorie des Satzes vom Grund als Aprioritätslehre, in: Dieter Birnbacher (Hrsg.), Schopenhauers Wissenschaftstheorie: Der „Satz vom Grund“, Würzburg 2015, S. 15. 26 Vgl. Philipp Mainländer, Philosophie der Erlösung, Berlin 1876, S. 546. 27 Martin Morgenstern, Schopenhauers Theorie des Satzes vom Grund als Aprioritätslehre, in: Dieter Birnbacher (Hrsg.), Schopenhauers Wissenschaftstheorie: Der „Satz vom Grund“, Würzburg 2015, S. 20. 28 Kritik an Epikur als Materialisten finden sich noch in WI 60, 63, 650; WII 24, 203, 548. 29 Ernst Ziegler (Hrsg.), Arthur Schopenhauer. Pandectae. Philosophische Notizen aus dem Nachlass, München 2016, S. 147. 30 Rüdiger Safranski, Schopenhauer, S. 313. 31 Frederick C. Beiser, Pessimism in German Philosophy, 1860-1900, Oxford 2016, S. 63. 32 Von einer „therapeutischen“ Perspektive, die es bei Epikur (Willaschek 2 f.) und zu Schopenhauer (Yalom) gibt, wird hier abgesehen, da sie keine Argumente für die Frage dieser Arbeit im engeren Sinne liefert. 33 Vgl. Marcus Willaschek, Ist der Tod ein Übel, unveröffentlicht, Frankfurt, S. 1: „Tatsächlich ‚hängen‘ die meisten Menschen am Leben [...]“; Allerdings nicht bloß am Leben, sondern an ihrem Leben. 34 In Anlehnung an die in den Jahrbüchern der Schopenhauer-Gesellschaft gebräuchliche Normalzitierung. 35 Seitenkonkordanzen für die Werkausgaben finden sich bspw. in: Daniel Schubbe / Matthias Koßler (Hg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2018, S. 441 ff.