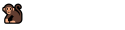Die große Bedeutung des Nichtwissens
Geht man zu einem Arzt, bekommt man nicht gerade das Gefühl, dass es in seinem Fachgebiet etwas gibt, was er nicht weiß. Alles, was es zu wissen gibt, weiß er. Geht man hingegen zu einem Wissenschaftler, oder gar zu einem Philosophen, so gibt es plötzlich viel weniger Antworten, dafür aber eine Unmenge an Fragen.
Es geht in diesem Artikel nicht um Erkenntnistheorie, Metaphysik oder Ontologie. Es geht darum, welche Arten von Wissen es gibt – auch ein wenig darum, welches Wissen man wirklich braucht:
(Mindestens) 4 Arten von Wissen gibt es
Seit Sokrates (469 v. Chr. bis 399 v. Chr.) kennt man den Satz "Ich weiß, dass ich nichts weiß.". Das nennt man Nichtwissen. Es gibt bekanntes und unbekanntes Nichtwissen. Die meisten Menschen können beispielsweise von sich behaupten, dass sie die Flagge von Uganda nicht kennen. Sie ist zwar ziemlich markant (Schwarz-gelb-rote Farben quergestreift mit Kronenkranich auf einem weißen Kreis in der Mitte) und könnte man sich leicht merken, aber aus dem Stegreif könnten sie wohl nur die Wenigsten skizzieren. Das ist bekanntes Nichtwissen, da man weiß, dass man es nicht weiß.
Unter unbekanntem Nichtwissen muss man alles einordnen, von dem man nicht weiß, dass man es nicht weiß. Je weiter man sich in ein bestimmtes Fachgebiet hinein wagt, desto mehr von bisher unbekanntem Nichtwissen wird man entdecken. Dann fällt es auch gar nicht so schwer, zu akzeptieren, dass diese Art von Wissen die mit großem Abstand größte Gruppe ist. Das Unwissen über das eigene Nichtwissen ist noch viel weiter als die Weiten der Weltmeere.
Das unbekannte Wissen ist die Sammlung aller Behauptungen oder Vermutungen, die man im Kopf hat, aber (noch) nicht überprüft hat. Dazu gehören auch grundsätzliche Annahmen über die Welt (und auch, ob es sie überhaupt gibt).
Das bekannte Wissen ist die vertraute Art von Wissen. Es sind die bekannten Tatsachen wie die eigene Augenfarbe, Mathematik oder ähnliche vermeintliche Wahrheiten. Doch könnte man hier natürlich fragen, wie denn eine gültige Wissensdefinition aussieht? Reicht es aus, wenn man eine gerechtfertigte und wahre Meinung von oder über etwas hat? Oder: Kann man überhaupt etwas wissen?
Man kann natürlich noch weiter unterscheiden: aktuelles/vergangenes/künftiges (un-)gewolltes (Nicht-)wissen usw. Doch wichtiger ist, wie mit (Nicht-)Wissen umgegangen wird:
Der Umgang mit (Nicht-Wissen)?
Albert Einstein wird folgendes Zitat zugeschrieben: ″Ego = 1/Knowledge″. Demnach könnten weniger wissende (umgangssprachlich: "dumm") Menschen ein größeres Ego, also mehr Selbstvertrauen, haben als mehr wissende Menschen.
Es mag Menschen geben, die nach der Lektüre eines Geschichtsbuches sofort meinen, sie verstünden die ganze Welt (und ihre Zukunft). Das kann einem richtig vorkommen, wenn man das folgende Zitat von Weizsäcker im Kopf hat: "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren." Es stellt sich nur die Frage, ob die Annahme, alles zu wissen, dabei hilfreich ist, noch mehr zu lernen.
Der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt scheint dagegen eher dafür zu sprechen, dass man sich nicht für zu kompetent hält. Die US-Psychologen David Dunning und Justin Kruger hatten 1999 den Zusammenhang von Inkompetenz und Einschätzung der eigenen Inkompetenz experimentell überprüft. Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass man aus einem größeren Selbstvertrauen nicht auf eine geringere Kompetenz schließen kann, allerdings, dass Inkompetenz positiv mit einer höheren Selbsteinschätzung korreliert. Ein nicht ganz ausreichender Erklärungsansatz lautet so: "Wer sich für kompetent hält, hat weniger Motivation, sich noch mehr Wissen anzueignen." Dabei würde man allerdings übersehen, dass man laut Dunning und Kruger nicht vom Ego auf die Kompetenz schließen kann. Wohl aber kann man vermuten, dass eine geringere Kompetenz weniger Möglichkeiten bietet, die Grenzen der eigenen Kompetenz zu erkennen.
Damit ist das Einstein zugeschriebene Zitat zwar widerlegt, dennoch ist ein mit Vorsicht zu genießendes schönes Resultat für Menschen mit geringem Selbstwertgefühl zustande gekommen. Dies wird auch unterstützt von Shakespeare mit folgendem Zitat: "Der Dumme denkt er sei weise, der Weise weiß aber um seine Dummheit."
Es gibt also niemals einen Grund für Prahlerei, sondern immer nur für Demut.