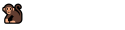Der Wert von Autoritätsargumenten
Argumente sollen durch ihre Prämissen und ihre Form von einer Konklusion überzeugen. Falls die Prämissen wahr sind und die Form des Arguments gültig ist, so muss die Konklusion wahr sein. Ganz nüchtern: „Das Argumentieren erfüllt seinen Zweck nur, falls sich einsehen lässt, dass die Konklusion wahr sein muss, falls die Prämissen wahr sind, ohne dafür schon wissen zu müssen, ob die Konklusion wahr ist.“1 Das soll die Praxis des Philosophierens sein. Es geht um zuerst um Sätze und ihre Beziehungen zueinander und zuletzt um das Überprüfen der Konklusion selbst. Dadurch ist es möglich, systematisch kontroverse Thesen zu diskutieren, wie es beispielsweise David Benatar als analytischer Existenzialist in seinem Werk Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into Existence unternimmt und eine „(moral) duty not to procreate“2 verteidigt. Das sachliche und ergebnisorientierte Argumentieren ist das eine, ideale Ziel der Philosophie.
Wie allerdings auch bekannt ist, sind „die objektive Wahrheit eines Satzes und die Gültigkeit desselben in der Approbation der Streiter und Hörer […] zweierlei.“3 Bewusst oder unbewusst kann es auch einmal bloß darum gehen, Recht zu bekommen – oder sich im Recht zu fühlen. Diesem anderen Ziel bietet sich als Mittel das Autoritätsargument an – oder argumentum ad verecundiam (Argument an die Ehrfurcht),4 um mich hier selbst dieses Mittels durch die Verwendung der lateinischen Sprache zu bedienen.
In der vorliegenden Arbeit wird nun exemplarisch ein Autoritätsargument in John Perrys Dialog über personale Identität und Unsterblichkeit untersucht. Hierfür wird zunächst die historische Bedeutung des Autoritätsarguments in der Philosophie aufgezeigt und darauf werden der Kontext und das Argument dargestellt und analysiert. Die Arbeit hat am Ende ihr Ziel erreicht, wenn sie dargestellt hat, welche Berechtigung Autoritätsargumente heute (noch) haben.
Inhalt
Autoritätsargumente
Autoritätszitate im Mittelalter
Prominent waren Autoritätszitate besonders im 12./13. Jahrhundert in der Textgattung der Quaestio. Ursprünglich wurden in den ersten Universitäten dieser Zeit klassische Texte ausgelegt. Bedeutungsvoll waren den Scholastikern neben der Bibel auch die Texte der Kirchenväter und der antiken Philosophen, besonders Aristoteles. Wenn es zwischen diesen Texten, welche im Hochmittelalter die eigentlichen Autoritäten waren (und nicht die Autoren), Widersprüche gab, bzw. ein solcher Anschein entstand, so hatte ein Magister eine Entscheidung auf Grundlage dieser Texte zu fällen gehabt. Es wurde in dieser Sache eine geschlossene Frage formuliert und dann zunächst stark in sogenannten obiectiones, also Einwänden, für die Antwortmöglichkeit argumentiert, die nicht der Meinung des Magisters entsprach. Dafür wurden Autoritäten herangezogen. Dann folgte die ausführlichere Darlegung der Position des Magisters, für welche er auch Autoritäten anführte. Schließlich folgte seine Reaktion auf die obiectiones der Autoritäten, welche vermeintlich zu ihm in Widerspruch standen. Ziel dieser ganzen Bezüge auf die antiken Texte war es nicht, die einen für sich zu nutzen und die anderen zu widerlegen oder gar zu diskreditieren, sondern erstens, sie so zu deuten, dass man sich konsistent in der bestimmten Frage auf sie gleichermaßen berufen kann und Widersprüche aufzulösen. Zweitens sollte der Magister auf den Schultern der Autoritäten stehen können und eine Weiterentwicklung betreiben. Neben der Logik war die antike Tradition die zweite große Säule der Scholastik.5 Dies war zugleich systematisch hilfreich, aber auch der eigenen Autorität nützlich.
Die Autoritätszitate funktionierten also nicht nach dem Schema:
- Doktor X meint, dass p.
- Also: p.
Eine Autorität ersetzte in dieser Tradition nicht ein Argument, sie galt nicht als eine Art dogmatische Setzung. Im Gegenteil: War ein antiker Text von großer Bedeutung, eine Autorität, und widersprach sie einer gängigen Ansicht, so wurde dies zum Anlass genommen, mit der Methode der traditionellen Logik nach Aristoteles und der Textauslegung zu Argumentieren. Wohl aber wurden Autoritäten ge- oder benutzt, um sich selbst Autorität oder wenigstens Legitimation zu verleihen. Zu diesem Zweck wurden Autoritäten bisweilen auch sehr weit ausgelegt.
Der Oberste Gerichtshof in John Perrys Dialog
Im fiktiven Dialog über personale Identität und Unsterblichkeit diskutieren die sterbende Philosophiedozentin Gretchen Weirob, ihr ehemaliger Student Dave Cohen und der Kaplan Sam Miller über die Möglichkeit der Unsterblichkeit, von der Weirob gerne überzeugt werden will, und darüber, was für die Definition der Unsterblichkeit notwendig ist, nämlich eine Definition der personalen Identität. Am dritten Abend bringt Cohen die Position Weirobs auf den Punkt: Für sie ist eine Person „ein menschlicher Körper, der lebt und gewisse Fähigkeiten hat – Bewusstsein und vielleicht rationales Denken.“6 Nachdem Weirob dies bejaht, versucht Cohen mit der Geschichte über einen Unfall sie davon zu überzeugen, dass ihre Auffassung in mindestens einem Fall problematisch ist, und sie ihre Definition modifizieren muss. Dabei geht es um eine Person A, die nach einem Unfall einen „zerstörten Körper“ und zugleich ein intaktes Gehirn hat, während eine Person B durch einen Schlaganfall ein „zerstörtes Gehirn“ und einen ansonsten intakten Körper hat. Die in dieser Fiktion angenommenen medizinischen Möglichkeiten erlauben es, das Gehirn der Person A in den Körper der Person B zu implantieren – eine Operation, die in dieser Handlung den Namen „Körpertransplantation“ trägt.7
Auch wenn dieser Begriff für einen kurzen Moment kontraintuitiv erscheinen mag, da bei einer Transplantation üblicherweise ein Körperteil verpflanzt wird, so ergibt sich doch der landläufigen Meinung von Körper und Geist entsprechend, dass in diesem Fall der Körper implantiert wird, oder wie der Neurologe Manfred Spitzer es ausdrückt: „Das Gehirn ist das einzige Organ, bei dessen Transplantation jeder lieber der Spender ist als der Empfänger.“8 Doch eben genau das ist die Frage, die sich in diesem Dialog stellt: Während auch in dieser Geschichte die überwiegende Mehrheit der Protagonisten Manfred Spitzer zustimmen, so auch Cohen und Miller, und dabei personale Identität zumindest in einen starken Zusammenhang mit der Gehirn-Materie bringen, ist Weirob der Überzeugung, dass nach der „Körpertransplantation“ die Person B überlebt. Dies ist für sie auch der Grund, eine solche Operation für sich selbst nicht in Betracht zu ziehen.
Argumentativ bringt Cohen für sich den Umstand in Stellung, dass sich in dieser Erzählung der Mensch mit Körper B und Gehirn A die Erinnerungen von A habe und somit A sein müsse. Dem erwidert Weirob, dass (zunächst) nichts weiter behauptet werden könnte, als dass der Anschein dieser Erinnerungen bestünde, und sie glaubt, dass Person B mit fälschlichen Erinnerungen überlebt hat, trotz des A-Gehirns.
Um dieser vermeintlichen Irrationalität9 Gretchen Weirobs noch etwas entgegen bringen zu können, nutzt Cohen ein Autoritätsargument: Er verweist darauf, dass – in der im Dialog genannten Geschichte – der Oberste Gerichtshof diesen Fall entschieden habe, und zwar zugunsten seiner Auffassung. Demnach sei entschieden, dass der B-Körper mit A-Gehirn die personelle Identität von Person A habe, also A die Operation überlebt hat. Das Muster dieses Arguments ist also:
- Institution X sagt, dass p.
- Also: p.
Im Gegensatz zu den Scholastikern nimmt Cohen die von ihm als Autorität verstandene Ansicht des Obersten Gerichtshof nicht als Anlass, diese mit jener Ansicht der Lehrperson argumentativ zu konfrontieren und Deutungen zu entwickeln bzw. allen Ansichten wohlwollend zu begegnen. Jene Ansicht nannte er irrational und diese des Obersten Gerichtshofes bringt er in einer Manier vor, die an die Eristische Dialektik erinnert:
„[…] man hat also leichtes Spiel, wenn man eine Autorität für sich hat, die der Gegner respektiert. Es wird aber für ihn desto mehr gültige Autoritäten geben, je beschränkter seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind. Sind etwa diese von erstem Rang, so wird es höchst wenige und fast keine Autoritäten für ihn geben. Allenfalls wird er die der Leute vom Fach in einer ihm wenig oder gar nicht bekannten Wissenschaft, Kunst, oder Handwerk gelten lassen: und auch diese mit Mißtrauen. Hingegen haben die gewöhnlichen Leute tiefen Respekt für die Leute vom Fach jeder Art.“10
Einschränkend ist allerdings zweierlei zu sagen: In diesem nicht extrem voraussetzungsreichen, eingängig geschriebenen Band handelt es sich um einen Dialog. Die fiktive Person Cohen hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht, eine theoretische Abhandlung zu formulieren. In Dialogen wird weniger reflektiert als im stillen Kämmerlein. Zudem handelt es sich um eine angespannte und zuweilen stressige (wenigstens gestresste) Situation, da Cohen und Miller immer wieder von der sterbenden (sic!) Gretchen Weirob gedrängt werden, sie von ihrer Möglichkeit des Weiterlebens nach ihrem Tod zu überzeugen. Ihre Zeit läuft ab und sie will überzeugt werden – und zwar schnell.11
Es handelt sich zwar um ein Autoritätsargument, das als solches nicht per sé überzeugend ist, aber nicht zum Rechthaben gedacht ist. Auch erkennt Cohen selbst, spätestens nach dem Einwurf von Weirob, dass diese Institution nicht unfehlbar ist. Er verändert seine Argumentation, in dem er auf Argumente verweist, die vom Obersten Gerichtshof stammen, stammen könnten oder die ihn aufgrund seiner Wirkung als anerkannte Autorität miteinbeziehen:
Ob zur Bildung einer personalen Identität die körperliche Identität12 oder Gedächtnisinhalte bzw. Charakterzüge relevant sind, macht Cohen hier zu einer Frage der Konventionen, auf die der Oberste Gerichtshof zwar auch reagiert, aber eben auch formuliert. In Bezug auf Tatsachen gibt Cohen eine Möglichkeit der Fehlbarkeit des Gerichtshofes zu, während er seine Autorität in Bezug auf Begriffe wie „Person“ mit Verweis auf seine formalen Aufgaben stärkt.13 Dabei ruht seine Argumentation wieder implizit auf einem Autoritätstext, nämlich der Verfassung. Diese Autorität wiederum bleibt nicht nur ungenannt, sondern scheint ihm auch nicht hinterfragbar zu sein. Dieser „Verweis“ ist keiner im Sinne eines Rechthaben-Scheins, sondern eine Information über die Haltungen dieser Person. Weirob führt den Begriff der Konvention ein, den Cohen bislang nicht in den Mund nahm, und zeigt damit auch ihre Haltung zu dieser Konvention, von der alles abhängen soll: Auch sie ist gewissermaßen nicht vom Himmel gefallen.
Fazit
Nun fragt sich, in Anbetracht der scholastischen Tradition und des Dialoges, ob Autoritätsargumente obsolet, unredlich oder gut sind. Zunächst ist festzustellen, dass grob drei verschiedene Typen von Autoritätsargumenten ausgemacht werden können:
Erstens Argumente, in denen Texten oder Personen eine Autorität zugesprochen wird, sodass ihre Aussagen miteinzubeziehen sind, wenn eine eigene Position entwickelt wird. Es handelt sich um Autoritäten, die nicht ignoriert werden dürfen, wiederum aber auch nicht so heilig sind, dass man ihre Positionen nicht notfalls wie Wachs passend machen darf. Das darf als scholastisches Autoritätsargument gelten.
Zweitens gibt es Argumente der Form, dass ein Text oder eine Person für eine Aussage steht, sodass diese Aussage durch ihre Quelle als wahr gilt. Das ist möglicherweise die Verfassung für die Figur Dave Cohen.
Dritter Art sind die Argumente, in denen auf Autoritäten verwiesen wird, aber der Verweis weniger der Quelle einer Aussage gilt, als vielmehr der Möglichkeit oder Tatsache einer guten Argumentation hinter der Aussage. Es scheint plausibel, dass Cohen in dieser Form den Obersten Gerichtshof ins Spiel bringt.
Welche dieser Formen sind nun gut – und in welchem Sinne? Fordert man Verständlichkeit und eine faire Prüfung von Überzeugungen sowie eine Orientierung an Ergebnissen einer ernsthaften Diskussion,14 dann kann es kaum gut sein, wenn Argumente des zweiten Typs gebraucht werden. Auch nicht besonders hilfreich sind Argumente der dritten Form, da sie wie die Argumente zweiter Art geeignet sind, eine Diskussion mit Dogmen enden zu lassen. Zudem werden bei dritten Form wichtige Prämissen unterschlagen, bzw. das Argument selbst. Trotz der bizarren Wirkung von Berufungen auf Bibeltexte scheint das „mittelalterliche“ Argumentieren des 13. Jahrhunderts am Ende dieser Arbeit am besten dazustehen, wenn die Nennung oder Anerkennung von Autoritäten überhaupt erwogen wird, da in dieser Form ein sachliches Streiten nicht nur ermöglicht, sondern auch befördert wird.
1 Holm Tetens, Philosophisches Argumentieren. Eine Einführung, München 2010, S. 24f. Hervorhebungen im Original. 2 David Benatar, Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into Existence, Oxford 2006, S. 14. 3 Arthur Schopenhauer, Die Kunst Recht zu behalten, Hamburg 2010, S. 10. 4 Vgl. ebd., S. 71. 5 Vgl. William J. Hoye, Die mittelalterliche Methode der Quaestio, in: Philosophie: Studium, Text und Argument, hrsg. von Norbert Herold, Bodo Kensmann u. Sibille Mischer, Münster 1997, S. 155-178. 6 John Perry, Dialog über personale Identität und Unsterblichkeit, Stuttgart 2013, S. 59. 7 Ebd., S. 61. 8 Manfred Spitzer, Was sich das Hirn so denkt beim Lernen, Vortrag 2010, im Internet verfügbar unter [https://www.spiraldynamik.com/newsarchiv/Portrait_201006_ManfredSpitzer.htm] (zuletzt überprüft am 13.02.2018). 9 Vgl. Perry, Dialog, S. 63. 10 Schopenhauer, Die Kunst, 2010, S. 71. 11 Vgl. Perry, Dialog, S. 34; auch S. 11, 15, 35 und 76. 12 In dieser Frage wird in diesem Kontext selten unterschieden zwischen Körper inkl. Gehirn und „Rest-Körper“. Das ist einigermaßen problematisch, da (auch hier implizit) oft auf eine Gehirn-Person-Identität verwiesen wird. 13 Vgl. Perry, Dialog, S. 64. 14 Vgl. Tetens, Philosophisches Argumentieren, 2010, S. 162f.