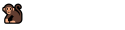Der Gemeinwille bei Jean-Jacques Rousseau
Immer größere Bevölkerungsteile schreien in Deutschland wieder „Wir sind das Volk!“ Die Legitimation der politischen Herrschaft in Deutschland wird immer mehr infrage gestellt, so stellen es die Medien in den letzten Jahren immer wieder fest. Gerade in dieser Frage wird nun wieder Jean-Jacques Rousseau aktuell, wie es die Philosophie-Zeitschrift Hohe Luft meint1 und fragt, wie ein ungeschriebener und doch gültiger Gesellschaftsvertrag neu ausgehandelt werden könnte, um politische Herrschaft wieder zu legitimieren.
Das Konzept Rousseaus zur Legitimation politischer Herrschaft basiert auf dem Begriff des „Gemeinwillens“, welcher in Opposition zu individuellen Interessen steht und auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist.
Dieser Gemeinwille von Jean-Jacques Rousseau ist allerdings mit negativen Assoziationen belegt und wird immer wieder mit Rechtfertigungen für totalitäre Herrschaftsformen in Verbindung gebracht.2 Das liegt etwa an dieser Passage, die bei Kersting zum Satz „von Hegel zu Hitler, von Rousseau zu Stalin“3 führte:
„Wer dem Gemeinwillen den Gehorsam verweigert, wird von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen. Was nichts anderes heißt, als daß man ihn dazu zwingt, frei zu sein.“4
Ebenso spricht dafür der Hinweis Rousseaus, dass zwar der Gemeinwille nie irrt, wohl aber das Volk,5 da der Gemeinwille nicht einfach einzusehen ist. Daraus scheint es ableitbar, dass eine Elite, die Einsicht in das Gemeinwohl bzw. den Weg dorthin, also den Gemeinwillen, hat, gegen Widerstände aus dem Volk ihre Interessen durchsetzen kann.
In dieser Arbeit sollen nun anhand von Rousseaus Werk Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtszunächst Vorschläge zur Legitimation von Herrschaft diskutiert werden, um zu verstehen, an welcher Stelle der Gemeinwille einsetzt und wozu er gebraucht wird. Daraufhin soll dargestellt und diskutiert werden, was unter “Gemeinwille“ bzw. „volunté générale“ zu verstehen ist oder was Rousseau darunter versteht und welche Plausibilität mögliche Interpretationen haben.
Inhalt
Vorschläge zur Legitimation von politischer Herrschaft
Natur: Der Staat als Familie
Unbestritten ist zu zunächst für Rousseau und auch andere Vertragstheoretiker, dass es einer gesellschaftliche Ordnung bedarf, um das Zusammenleben (wenn das schon nicht infrage gestellt wird) zu ordnen. Es braucht eine Form politischer Herrschaft. Doch welche Legitimation kommt dafür in Betracht?
Als erstes Argument für eine gerechtfertigte Herrschaft diskutiert Rousseau im zweiten Kapitel des ersten Buches die Idee, der Staat sei im Grunde nicht mehr als eine große Familie.6 Das Argument läuft so:
- Herrschaft ist in einer Familie legitim.
- Ein Staat ist eine Familie.
- Also ist Herrschaft in einem Staat legitim.
Als attraktiv gilt dieses Argument Rousseau, da die Familie eine natürliche Gesellschaft sei und, falls der Staat nicht mehr als eine Familie wäre, auch die politische Herrschaft in diesem Sinne als natürlich gelten könne. Somit wäre die Legitimation der Herrschaft auf die Natur reduziert.
Rousseau verwirft dieses Argument, in dem er Prämisse 2 angreift und zeigt, dass im Gegensatz zur Herrschaft in Staaten, in Familien sich die Herrschaftsstrukturen auflösen, sobald die Phase der biologischen Abhängigkeit beendet ist, die Kinder dem Vater keinen Gehorsam mehr schulden und sich das „natürliche Band [löst]“.7
Sollten sich die Bande nicht auflösen, obwohl es biologisch möglich wäre, so hat das nach Jean-Jacques Rousseau den Grund, dass es noch weiter Nutzen bringt. Dagegen könne man das nicht von einem Monarchen behaupten, da dieser nicht für den Bürger sorgt – im Gegenteil: Sie haben ihren Monarchen zu verteidigen in Kriegen, die sie nicht anzetteln.
Recht des Stärkeren
Dass Herrschaft legitim ist, wenn der Herrscher physisch stärker als seine Untertanen ist, meint nach Rousseau das sogenannte Recht des Stärkeren. Er bestreitet nicht, dass physisch Unterlegene dem Stärkeren selten widersprechen, allerdings bestreitet er, dass mittels dieser Stärke ein wahres Recht geschaffen werden kann.
Rousseau macht sich über den Begriff „Recht des Stärkeren“ lustig, in dem er ihn so versteht, als meinte jemand damit, dass das Wort „Recht“ der Stärke noch etwas hinzufügt. Der Stärkere kann kein Recht begründen, das auf seiner Stärke basiert, das ohne seine Stärke noch weiterbesteht. Es ist schlichtweg redundant. Rousseau zeigt diese Absurdität mit einem Beispiel: Einem bewaffneten Räuber die eigene Geldbörse auszuhändigen anstatt Gegenwehr zu leisten ist klug, weil dadurch das eigene Leben geschont wird. Wenn es sich jedoch ergibt, dass man die Geldbörse dem Räuber unterschlagen kann, so kann keineswegs davon gesprochen werden, dass man aufgrund der Stärke des Räubers damit eine Pflichtverletzung begehen würde.8
Sklaverei
Nach den beiden Vorschlägen zur Legitimation von politischer Herrschaft, der natürlichen Gesellschaft und der Stärke, bleibt für Rousseau bloß noch die Möglichkeit der Vereinbarung zwischen Menschen. Rousseau stellt die Frage, ob Sklaverei als eine Form von Herrschaft Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Menschen sein kann. Er behauptet, dass dies unmöglich sei, da erstens ein Mensch mit der Aufgabe aller seiner Rechte und sogar menschlichen Pflichten eine Handlung vollziehen würde, die der menschlichen Natur widerspräche. Und zweitens wäre eine solche Vereinbarung laut Rousseau ein nichtiger Vertrag, da eine Seite alles erhielte und nichts zu geben bräuchte.9
Hier widerspricht sich Rousseau allerdings, da er anfangs in diesem vierten Kapitel des ersten Buches noch meinte, dass ein Mensch sich nicht in die Sklaverei verschenken könne, da „schenken“ bedeute, dass man keine Gegenleistung erhalte, allerdings bekomme ein Mensch in der Sklaverei wenigstens seinen Unterhalt.10
Das kleine Problem der obigen Argumentation Rousseaus ändert freilich nichts daran, worauf sein Widerspruch zur Sklaverei fußt: So oder so kann es keinen rechtmäßigen Weg in die Sklaverei geben. Zu einseitige Verträge können nicht gültig sein und auch kann man Menschen nicht vor die Wahl „Sklaverei oder Tod“ stellen, da dies bedeuten würde, dass ein Mensch nicht das alleinige Recht auf das eigene Leben hat.11
Gesellschaftsvertrag
Braucht es unbedingt einen Gesellschaftsvertrag zur Legitimation von Herrschaft? Kann man nicht einfach einen Herrscher wählen? Rousseau beantwortet diese Frage negativ, da ohne einen Vertrag keine Pflicht bestünde, sich einem Mehrheitsentscheid zu unterwerfen, wenn eine Gruppe von Menschen einen Herrscher mehrheitlich wählen würde.12
Die Aufgabe, die eine Gesellschaft zu lösen hat, beschreibt Rousseau im sechsten Kapitel nun so:
„Finde eine Form des Zusammenschlusses, der mit seiner ganzen gemeinsamen Kraft Person und Habe jedes einzelnen, der ihm angehört, verteidigt und beschützt und durch den dennoch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor!“13
Das Ziel ist die Selbstherrschaft. Für Rousseau scheint es möglich, dass jedes Individuum sich einer Gesellschaft unter einer Vereinbarung nach oben genannter Maßgabe „hingibt“, sodass keine Einzelpersonen mehr handeln, sondern bloß noch eine Körperschaft, die „ein gemeinschaftliches Ich, ein Leben und einen Willen erhält.“14 Dies erinnert nicht zufällig an ein Bild von einem Körper. Rousseau vergleicht den Staat mit einem Körper, der als ganzes einen eigenen Willen erhält.15 Einzeln sind die Menschen ohne Zusammenschluss schwächer und zudem haben sie mit anderen Menschen Interessenskonflikte. Der Zusammenschluss zu einem Organismus ermöglicht, dass sie in einer Einheit aufgehen, die einen eigenen Willen hat, der von den Individuen bloß als gemeinsam erkannt werden muss.16
Bevor der gemeinschaftliche Wille näher erörtert wird, sind einige andere Begriffe zu klären:
Ein durch Vereinbarung entstandener Bund von Menschen wird bei Rousseau Staat genannt, wenn dieser Bund passiv ist. Ein aktiver Bund wird Souverän genannt und im Vergleich mit anderen Staaten nennt Rousseau (bzw. die dt. Übersetzung) den Staat Macht.17
Die durch Vereinbarung aneinander gebundener Menschen nennen sich nach Rousseau Volk. Damit ist die Gesamtheit der Menschen gemeint.
Die unter diese Vereinbarung fallenden Menschen des Bundes bzw. Staates, also die Menschen, die dem Volk angehören, haben bei Rousseau je nach Rolle oder Perspektive zwei unterschiedliche Begriffe: Sie sind Untertanen und Bürger. Erstere sind sie als solche, die unter die Gesetze fallen und Gehorsam leisten müssen, letztere sind sie als Teil des Souveräns. Die Selbstgesetzgebung ist also eine Gesetzgebung von Bürgern für Untertanen.
Rousseau gesteht jedem Individuum die Möglichkeit zu, einen Sonderwillen zu haben, der abweicht vom Gemeinwillen des Souveräns.18 Während der Souverän erkennt, was der richtige Weg zum Wohlstand aller Bürger ist, kann der Bürger als Untertan dennoch einen von dem Ganzen, dessen Teil er ist, abweichenden Willen entwickelt. Es kann sogar sein, dass ein solcher Mensch bloß seine Bürgerrechte wahrnimmt und seine Pflichten als Untertan unerfüllt lässt. Solche Ungerechtigkeiten führen nach Rousseau zum Untergang des politischen Körpers. Mit diesem Kontext kommt es zum bekannten Zitat, dem Zwang zur Freiheit:
„Wer dem Gemeinwillen den Gehorsam verweigert, wird von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen. Was nichts anderes heißt, als daß man ihn dazu zwingt, frei zu sein.“19
Was ist also der Gemeinwille, zu dessen Gehorsam mit Zwang verholfen werden darf und sogar muss?
Rousseaus Gemeinwille
Verschiedene „Willen“
„Der Mensch wird frei geboren, und überall liegt er in Ketten. Wer glaubt, andere zu beherrschen, ist nur noch mehr Sklave als jene. Wie hat sich dieser Wandel vollzogen? Das weiß ich nicht. Was kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen? Auf diese Frage glaube ich eine Antwort zu haben.“20
Wohl kaum ein Absatz von Rousseaus Werken wird noch öfter zitiert als dieser. Er macht die nämlich Kernfrage seines Anliegens im Gesellschaftsvertrag klar: Wie lässt sich politische Herrschaft rechtfertigen?
Die Beziehungen zwischen Staat und Bürger sind im vorigen Abschnitt bereits dargelegt. Und es wurde klar, dass es Einzelinteressen oder Einzelwillen (Volonté particulière) und einen auf das Allgemeinwohl ausgerichteten Gemeinwillen (Volonté générale). Daneben gibt es noch den Gesamtwillen, der nicht mehr ist als die Summe aller Einzelwillen (Volonté de tous). Wie Rousseau 1755 muss man nun fragen: „Wie soll man aber, so wird man mich fragen, den Gemeinwillen in den Fällen kennen, in denen er sich nicht ausgesprochen hat?“21 Oder einfach: Was ist er und woher kommt er?
Jean-Jacques Rousseau definiert den Gemeinwillen im Gesellschaftsvertrag selbst nur dürftig. Neun Kapitel des ersten Buches und zwei des zweiten vergehen mit Erwähnungen des Begriffs hier und da, doch erst darauf kommt etwas, das ansatzweise als eine Definition gelten darf:
So schreibt Rousseau im dritten Kapitel des zweiten Buches, dass der Gemeinwille nicht irren kann. Wir würden immer wollen, was gut für uns ist, aber es nicht immer erkennen. Zwischen dem Gesamtwillen und dem Gemeinwillen könne oftmals eine große Lücke klaffen. Der Gesamtwille, also die Summe individueller Wünsche, ist nicht gleich dem Interesse am Gemeinwohl.22 Darauf bringt Rousseau seine Definition:
„Zieht man jedoch von diesen individuellen Wünschen das Mehr und das Weniger ab, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemeinwille.“23
Klar wird dadurch noch nicht, was der Gemeinwille ist. In jedem Fall scheint es so, als ob es ohne Unterschiede in den Interessen der Menschen, ohne Konflikte, kein Problem beim Finden des Gemeinwillen gäbe. Was individuell gewollt wird, entspräche dann nämlich dem Gemeinwillen. Doch könnte dies wirklich ohne Irrtum zum Allgemeinwohl führen? Diese Definition steht zudem offenkundig im Widerspruch zu der Behauptung, dass es schwierig sei, ihn zu erkennen: Wenn der Gemeinwille durch die Summe der Unterschiede der Einzelwillen zu erkennen wäre, dann ist dies allerdings keine große Schwierigkeit.
Denkt man eine kleine Anzahl an Bürgern eines Staates mit ihren Wünschen als Teile eines Organismus, so ist es schwer vorstellbar, wie man den Willen erkennen soll, der zum Allgemeinwohl führen kann. Es ist nicht damit getan, Unterschiede zu beachten.
Patrick Riley meint so auch, dass die Idee des Gemeinwillen eine Unmöglichkeit ist, und dass sich Rousseau deshalb so schwer tut, den Gemeinwillen positiv zu definieren und nur ausschließt, was er nicht sein kann. Ein Wille ist nach Riley ein psychologisches Konstrukt, das Individualität bedingt und die Idee von Allgemeinheit ausschließt.24
Betrachtet man nochmals das Zitat aus dem sechsten Kapitel des ersten Buches und dazu das zwölfte Kapitel des zweiten Buches, so bieten sich zwei mögliche Erklärungen für den Gemeinwillen an.
Aus dem sechsten Kapitel des ersten Buches:
„[...]indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor!“25
Aus dem zwölften Kapitel des zweiten Buches:
„Zu diesen drei Gesetzesarten fügt sich noch eine vierte, die wichtigste. Sie steht weder in Marmor noch in Erz, sondern in den Herzen der Bürger eingeschrieben. Sie bildet den eigentlichen Kern der staatlichen Verfassung. Sie erlangt mit jedem Tag neue Kraft. Sie haucht den anderen Gesetzen, wenn sie altern oder verblassen, wieder Leben ein oder tritt an ihre Stelle.“26
Man könnte den Gemeinwillens damit erklären, dass idealerweise Menschen wirklich aufgehen in der Gemeinschaft und die Interessen der Gemeinschaft zu den Interessen der Individuen werden (These A). Oder aber der Begriff „Gemeinwille“ ist schlecht gewählt bzw. wird schlecht verstanden, weil der „Wille“ eine Entität zu postulieren scheint, die über die „bloße“ Idee, das Allgemeinwohl zu verfolgen (These B), hinausgeht und (größere) erkenntnistheoretische und ontologische Schwierigkeiten erzeugt.
These A: Das Ende aller Individualität
Möglicherweise meinte Rousseau mit dem Gemeinwillen tatsächlich eine gemeinsame Entität, einen gemeinsamen Willen, wie auch die verschiedenen Körperteile eines einzelnen Menschen sich dem einen Willen unterordnen.
Es kann in der Philosophie kein Argument sein, zu sagen, dass es absurd klingt. Rousseau mag man jedoch nicht vorwerfen, dass er als einer der große Vorbilder der Kämpfer der Französischen Revolution gegen Individualität schrieb. Allerdings ist das gesamte, nicht kleine, aber dennoch überschaubare Schaffen von Jean-Jacques Rousseau, auch schon im Gesellschaftsvertrag voller Widersprüche, wie Wolfgang Kersting feststellt: „Rousseaus politikphilosophisches Hauptwerk ist uneinheitlich, spannungsvoll und widersprüchlich.“27
So ist es nicht verwunderlich, wenn auch Joshua Cohen, der eigentlich gegen diese These argumentiert, zugibt, dass Rousseau doch einiges an Belege für sie liefert.28 Rousseau schreibt nämlich im siebten Kapitel des zweiten Buches:
„Wer es wagt, einem Volk eine Verfassung zu geben, muß sich sozusagen befähigt fühlen, die menschliche Natur zu ändern. Er muß jedes Individuum, das für sich genommen ein vollendetes Ganzes ist, nur eben isoliert, in den Teil eines größeren Ganzen verwandeln, von dem dieses Individuum gewissermaßen Leben und Dasein empfängt. […] Kurz: er muß dem Menschen die ihm eigenen Kräfte nehmen, um ihm fremde Kräfte zu geben, die er ohne die Hilfe anderer nicht nutzen kann. Je mehr die natürlichen Kräfte absterben und vergehen, desto stärker und dauerhafter werden die erworbenen […] Das heißt: erst wenn kein Bürger mehr etwas ist oder vermag, es sei denn durch alle anderen, und wenn die dank der Gesamtheit erworbene Kraft der Summe der natürlichen Kräfte aller Individuen gleichkommt oder sie übersteigt – erst dann ist die Gesetzgebung auf dem höchsten Punkt der ihr möglichen Vollendung angelangt.“29
Jedes Individuum und jeder individuelle Wille erlischt, da sie in der größeren Körperschaft aufgehen. Zur Erinnerung: Was passiert mit einem Glied der Körperschaft, wenn es aus der Reihe tanzt? Es darf und muss wieder eingefügt werden – in Reih und Glied gewissermaßen –, um die politische Körperschaft zu retten. Man darf und muss zur Freiheit zwingen.30 Auch wenn es dann weder nach Rousseau noch nach Freiheit klingt. Die Gemeinschaft steht über allem.
Im ersten Kapitel des vierten Buches vom Gesellschaftsvertrag liefert Rousseau abermals Argumente für diese These, in dem er schreibt, dass der Gemeinwille unzerstörbar sei und es automatisch keinerlei widersprechender Interessen gäbe. Alle Triebkräfte des Staates seien einheitlich, da sich alle Menschen als eine einzige Körperschaft wahrnehmen und nur einen einzigen, gemeinsamen Willen haben. Sollte eine solche Gemeinde (wie etwa in der Schweiz seinerzeit) einmal darunter leiden, dass die gesellschaftlichen Bande schwächer werden, selbst dann noch merkt jeder einzelne Bürger noch, dass der Gemeinwille unzerstörbar ist, andere Willen sich bloß über ihn gelegt haben, man sich aber nicht gänzlich abkoppeln kann vom Gemeinwillen.31
Auch in Rousseaus Erziehungsroman scheint der Einzelne dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau nichts zu gelten, die Gemeinschaft ist alles:
„Der natürliche Mensch ist ein Ganzes für sich; er ist die numerische Einheit, das absolute Ganze, das nur zu sich selbst oder zu seinesgleichen in Beziehung steht. Der bürgerliche Mensch ist nur eine gebrochene Einheit, welche es mit ihrem Nenner hält, und deren Wert in ihrer Beziehung zu dem Ganzen liegt, welches den sozialen Körper bildet. Die guten sozialen Einrichtungen vermögen den Menschen am ehesten seiner Natur zu entkleiden, ihm seine absolute Existenz zu rauben, um ihm dafür eine relative zu geben, und das Ich in die allgemeine Einheit zu versetzen, so daß sich jeder einzelne nicht mehr für eine Einheit, sondern für einen Teil der Einheit hält und nur noch in dem Ganzen wahrnehmbar ist. Ein römischer Bürger war nicht Cajus, nicht Lucius, er war ein Römer [...]“32
Darüber hinaus liest sich auch Rousseaus Kapitel über die Zensur (Buch 4, Kap. 7) im Einklang mit der These, dass das Individuum in der Gesellschaft verschwindet bzw. mit ihr eins zu werden hat:
„Wie sich der Gemeinwille im Gesetz ausdrückt, so die öffentliche Meinung in der Zensur. Die öffentliche Meinung ist eine Art Gesetz, als dessen Sachwalter der Zensor fungiert […] Das Zensorenamt richtet also keineswegs über die Volksmeinung, sondern ist nur deren Sprachrohr.“33
Viel eindeutigere Passagen für den Totalitarismus sind kaum denkbar: Was der Zensor macht, ist richtig, weil es im Sinne des Gemeinwillens ist. Der Zensor macht, was das Volk will – oder wirklich will. Wer zensiert wird, muss gegen den wahren Willen des Volkes verstoßen haben. Auch dies spricht eindeutig dafür, dass das Individuum in der Gemeinschaft unterzugehen hat.
Aber angenommen, diese These ist richtig: Wie findet diese homogene „Gesellschaft“ ihren zum Allgemeinwohl führenden Gemeinwillen? Dass sie bestrebt ist, ihn zu finden, daran besteht innerhalb der These A kein Zweifel – das wäre undenkbar. Dennoch ist es nicht einfach zu sagen, woher a) dieser eine Wille kommt, und woher b) das Wissen um den Weg zum Allgemeinwohl generiert wird? Diese These löst die Frage nicht, woher der Gemeinwille kommt. Auch wenn man noch aus dem bereits zitierten Artikel Economie politique entnimmt, dass der Gemeinwille sich per Vernunft aus dem partikularen bestimmt, also dass eine gute Bildung zu dem das Gemeinwohl wollenden Gemeinwillen wird,34 ist diese Frage noch nicht gelöst. Dafür wird allerdings wieder einmal der Verdacht erhärtet, dass ein totalitäres System die Menschen richtig zu bilden hat, sodass am Ende eine homogene Masse mit einem Willen steht – ohne eine Chance auf Pluralismus.
Joshua Cohen gesteht den Verteidigern dieser These, auch „complete civic unity“ genannt, zu, dass nicht sie übertreiben, sondern lediglich Rousseaus eigenen Zuspitzungen zu sehr im Fokus haben.35 Mit Briefen Rousseaus und anderen Primärquellen argumentiert Cohen, dass Rousseau Privatinteressen verteidigt und als bedeutsam erkannte. Auch im Gesellschaftsvertrag findet man Stellen, die gegen diese These sprechen. Rousseau spricht hier etwa im vierten Kapitel des zweiten Buches davon, dass Privatpersonen naturgemäß unabhängig in Leben und Freiheit seien, dass zu differenzieren sei zwischen Bürger und Souverän, und dass sich Untertanen in ihrer Eigenschaft als Menschen an Rechten erfreuen dürfen.36
Wenn nun die Argumente gegen diese „complete civic unity“-These qualitativ und quantitativ geringer wirken als die Argumente für diese These, dann liegt es zum einen daran, dass Rousseau nicht gegen ein politisches System geschrieben hat, sondern für eines, und dadurch nicht mögliche Einschränkungen individueller Freiheiten im Fokus haben musste, sondern sich dem Funktionieren eines politischen Systems widmen konnte und musste. Wird der Aufbau eines Staates dargelegt, sind einfacher Argumente gegen ihn zu sammeln; ebenso ist es einfacher, die Möglichkeit eines funktionierenden Staates zu bezweifeln, wenn man damit beginnt, welche Rechte ein Bürger haben sollte. Die Masse an Textstellen, die sich leicht im Kontext eines totalitären Systems denken lassen, bedeuten daher nicht, dass Rousseau so einzuordnen ist. Allerdings ist es sehr schwierig, sie im Einklang mit pluralistischen Ideen zu lesen.
Dass die Argumente gegen die „complete civic unity“-These qualitativ und quantitativ geringer wirken als die Argumente für diese These, dann liegt es zum anderen vielleicht daran, dass der Gesellschaftsvertrag nur ein Teil eines größeren Projekts von Rousseau gewesen war und er diesen Teil unvollendet veröffentlichen musste. Äußerst fraglich ist allerdings, ob die vielen Widersprüche in irgendeinem Kontext auflösbar gewesen wäre.37
These B: bloß Gemeinwohl
Patrick Riley vertritt die These, dass Rousseau anstelle eines psychologischen Willens, der von einer Gemeinschaft irgendwie erzeugt wird, bloß eine „politische Moral des Gemeinwohls“ gemeint hatte.38
Wenn man annimmt, die Qualität der deutschen Übersetzungen ist hervorragend und die Worte Rousseaus sind einwandfrei in deutsche Worte zu übersetzen, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass es reizvoll ist, sprachliche Harmonie herzustellen zwischen diversen Formen von Willen: Es gibt viele divergente Einzelwillen – jeder hat schließlich einen – und man könnte alle Einzelwillen einer Gemeinschaft äußern lassen und sammeln, um einen „Gesamtwillen“ zu erhalten. Postuliert man nun, dass es den einen Weg zum Wohl aller gäbe, zu dem alle gebildeten Menschen per Einsicht gelangen könnten, was ist ästhetischer als diesen Weg „Gemeinwillen“ zu nennen? Eine Entität, ein (Gemein-) Wille, die der Gemeinschaft eine Richtung gibt?
Für Rileys These sprechen, wie er aufzählt,39 Rousseaus Faszination von der antiken Moral des Gemeinwohls und Textstellen, in denen Jean-Jacques Rousseau von Sitten und Gebräuchen als vierte Gesetzesart spricht und davon, dass eine gute Erziehung das Gemeinwohl fördert.40 Hierbei geht es nicht um eine Unterordnung unter einen Willen dem Volkes, des Souveräns, sondern bloß um die Förderung des Gemeinwohls.
Die Schwierigkeiten Rousseaus, seinen Tugendbegriff von seinem Gemeinwillen begrifflich zu unterscheiden, sind erhellend, wie Riley feststellt:
„Daß die Übereinstimmung des partikularen mit dem allgemeinen Willen Tugend schafft, und daß Tugend nötig ist, um den partikularen Willen mit dem allgemeinen Willen in Übereinstimmung zu bringen? Daß es sich im Kreis bewegt, liegt nicht daran, daß Rousseau keine deutliche Konzeption von Tugend hatte, die antike Politik war seiner Beschreibung nach ein Modell an Tugend […] Die Kreisförmigkeit wird durch den Versuch veranlaßt, die Tugend als ein Einheit, als Gemeinschaftsbezogenheit von der Versöhnung des partikularen mit dem allgemeinen Willen abhängig zu machen, wogegen es sich tatsächlich so verhält […], daß Tugend als Übereinstimmung mit einer Moral des Gemeinwohls das Werk einer hervorragenden Gesetzgebung und politischen Bildung ist.“41
Tugendhaft ist es bei Rousseau, die eigenen Interessen in Einklang mit dem Gemeinwohl zu bringen, hierfür bedarf es allerdings schon der Tugend. Eine gute Gesetzgebung und eine gute Bildung sind die Schlüssel, um den Zirkel aufzubrechen. Doch wozu muss er vom „Gemeinwillen“ sprechen? Man könnte auch einfach „Gemeinwille“ durch „Gemeinwohl“ ersetzen und nichts wäre verändert am edlen Ziel und Rousseaus Vorschlag zur Lösung der Legitimationsfrage von politischer Herrschaft. Das Problem Rousseaus besteht darin, so Riley, dass Rousseau politische und moralische Begriffe zu verschmelzen versucht, und damit scheitert.42
Betrachtet man den Gemeinwille als Gemeinwohl, so kann man wieder etwas leichter verstehen, wieso das Leben in Rousseaus Gesellschaft frei machen soll (auch wenn eine Rechtfertigung eines Zwangs hierfür noch schwierig bleibt): Jedes Individuum hat zwar seinen eigenen Willen, ist aber um das Gemeinwohl bemüht, bzw. um Einsicht in das richtige Vorgehen für das Gemeinwohl. Keine partikularen Interessen herrschen in der Gemeinschaft vor, sondern das Bemühen um das Gemeinwohl. Nur in einer Gesellschaft mit dieser Ausrichtung ist Herrschaft legitim.
Fazit
Jean-Jacques Rousseau erstmals zu lesen birgt die Gefahr, geblendet werden von der Einfachheit der Sprache: Es gibt keine langen Schachtelsätze, keine langen, aufwendigen Argumentationsstrukturen oder logische Verästelungen. Es scheint unnötig, langsam Satz für Satz zu rekonstruieren. Rousseau ist nicht Kant. Schwierig ist Rousseau dennoch, besonders aufgrund der vielen Widersprüche. Aus philosophischer Sicht ist er zudem unbefriedigend, da er wenige Argumente liefert, sondern überwiegend Behauptungen aufstellt, die er in sein nicht sonderlich konsistentes System einbaut.43
Bei Rousseau schlagen alle Argumente fehl, die eine politische Herrschaft ohne einen Gesellschaftsvertrag zu legitimieren versuchen. Zum einen ist der Staat nicht einfach eine Familie, zum anderen gibt es kein „Recht“ des Stärkeren. Nur ein Gesellschaftsvertrag bringt Gerechtigkeit und Gleichheit. Zentral dafür ist allerdings, dass dem Gemeinwillen entsprechend gehandelt wird. Die Interessen der Individuen sind zurück- oder umzustellen.
Rousseaus Gemeinwille stellt Rätsel auf: Woher kommt er, was ist er und wie kommt man zu ihm? In dieser Arbeit wurden zwei Thesen aus der Literatur vorgestellt. Zum einen gibt es die „complete civic unity“-These, also die These, dass Individuen in der Gemeinschaft aufgehen und sich ihre Einzelinteressen auflösen. Sollten sich Individuen ihre Individualität erhalten wollen bzw. einen abweichenden partikularen Willen bewahren und sich nicht unterordnen wollen, so ist die Gemeinschaft berechtigt und verpflichtet, Abweichler wieder ein- bzw. unterzuordnen. Dieser These nach geht in Rousseaus Gemeinschaft Individualität unter und Pluralismus ist unmöglich. Rousseau anhand einiger Textstellen ein solches totalitäres System anzuhängen geht vermutlich etwas zu weit, obwohl Namen wie Robespierre, Hitler oder Stalin nicht selten in Rousseau-Besprechungen auftauchen.
Die These, dass der Gemeinwille letztlich kein metaphysisches Konstrukt ist, sondern nicht viel mehr als ein Gemeinwohl bedeuten soll, scheint eine wohlwollendere, aber auch sehr plausible These zu sein, da sein Fokus auf den innersten Überzeugungen der Bürger lag und die Vereinbarkeit individueller Interessen mit denen anderer Menschen ein wiederkehrendes Thema ist. Zudem ergeben sich aus Rousseaus Briefen und seiner Herkunft, dass ihm der Pluralismus und der Individualismus nicht fremd oder unerwünscht waren.
1 Vgl. Tobias Hürter, Das Kleingedruckte einer lauten Zeit, in: Hohe Luft. Ausgabe 3/2017, S. 33. 2 Vgl. Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 4, 86, 236. 3 Wolfgang Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002, S. 91. 4 Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 34. 5 Vgl. ebd., S. 49. 6 Vgl. Wolfgang Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002, S. 34. 7 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 13. 8 Vgl. ebd., S. 17. 9 Vgl. ebd., S. 20. 10 Vgl. ebd., S. 18. 11 Vgl. ebd., S. 23. 12 Vgl. ebd., S. 26. 13 Ebd., S. 28. 14 Ebd., S. 29. 15 Vgl. Günther Mensching, Jean-Jacques Rousseau zur Einführung, Hamburg 2000, S. 104 f. 16 Vgl. ebd., S. 106. 17 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 29 f. 18 Vgl. ebd., S. 33 f. 19 Ebd., S. 34. 20 Ebd., S. 12. 21 Jean-Jacques Rousseau in der Économie politique, zit. nach Karlfriedrich Herb, Verweigerte Moderne. Das Problem der Repräsentation, in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 167. 22 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 49. 23 Ebd. 24 Vgl. Patrick Riley, Eine mögliche Erklärung des Gemeinwillens (I 7, II 1-3), in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 121. 25 Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 28. 26 Ebd., S. 89. 27 Wolfgang Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002, S. 12. 28 Vgl. Joshua Cohen, Rousseau. A Free Community of Equals, New York 2010, S. 35. 29 Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 67. 30 Vgl. ebd., S. 34. 31 Vgl. ebd., S. 168. 32 Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung. Band 1 erstes Buch, Leipzig [o.J.],S. 13-97. [http://www.zeno.org/nid/20009264205] letzter Zugriff am 25.08.2018. 33 Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 205. 34 Vgl. Günther Mensching, Jean-Jacques Rousseau zur Einführung, Hamburg 2000, S. 110. 35 Vgl. Joshua Cohen, Rousseau. A Free Community of Equals, New York 2010, S. 36. 36 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 51. 37 Vgl. Wolfgang Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002, S. 13. 38 Vgl. Patrick Riley, Eine mögliche Erklärung des Gemeinwillens (I 7, II 1-3), in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 121. 39 Vgl. ebd., S. 121 f. 40 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Wiesbaden 2008, S. 89. 41 Patrick Riley, Eine mögliche Erklärung des Gemeinwillens (I 7, II 1-3), in: Reinhard Brandt (Hrsg.), Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 123. 42 Vgl. ebd., S. 124. 43 Vgl. Wolfgang Kersting, Jean-Jacques Rousseaus ‚Gesellschaftsvertrag‘, Darmstadt 2002, S. 12.