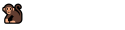Das philosophische Bootstrapping-Problem der Rationalität
Im Deutschen assoziiert man "Bootstrapping" selten mit der Philosophie, eher mit der Elektrotechnik, Programmierung, Statistik oder Ökonomie. Aber auch in der Philosophie ist der Begriff wichtig und interessant. "Bootstrap" ist englisch und bedeutet auf deutsch "Stiefelriemen". Wenn man von einem Bootstrapping-Problem spricht, so meint man damit etwas wie bei Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus einem Sumpf gezogen hat, oder man zieht sich an seinen Stiefelriemen über einen Zaun. Das ist natürlich blödsinnig.
Mehr über das Bootstrapping in der Informatik, in der Biologie, in den sog. Rechtswissenschaften oder in der Wirtschaft: https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping
Bootstrapping-Problem in der Philosophie
Das Bootstrapping-Problem ist ein Paradoxon, mit dem Schlussformen kritisiert werden. Es gibt Schlüsse der Art "Da x die Wahrheit spricht, haben wir den Beweis, das x zuverlässig als Zeuge/Zeugin ist". Das findet sich auch als Argument implizit in der Bibel, und wohl allen Buch-Religionen, wie in dieser Quaestio zum Kinderbekommen kurz erwähnt. Das sind tautologische Schlüsse, Zirkelschlüsse.
Es stellt sich die Frage, ob es eigentlich Alternativen zu Zirkelschlüssen gibt. Skeptiker haben das Münchhausen-Trilemma oder Agrippa-Trilemma parat und wenden Folgendes ein: Wenn man p behauptet, so kann man nach den Gründen für p fragen. Vielleicht sind das a und b. Dann kann man nach den Gründen für a und b fragen. Vielleicht kann oder wird kein Grund für b genannt, aber c als ein Grund für a. Und d als ein Grund für c. Und e als ein Grund für d, usw.
Beim Fragen nach Gründen kann man laut dem Münchhausen-Trilemma immer nur bei einem Zirkelschluss landen (also x begründet y und y begründet x), in einer dogmatischen Setzung (x ist wahr, kein Grund nötig) oder aber in einem infiniten Regress, also einem endlosen Fragen nach Gründen, ohne einen letzten Grund.
Das macht die Suche nach einem erkenntnistheoretischen Fundament schwierig. Wie soll man zu sicherem Wissen kommen? Descartes versuchte es mit seinem Rationalismus, einige versuchten es mit dem Empirismus und andere lehnen es vielleicht ab und sind Kohärentisten oder Pragmatiker.
Rationalität und Bootstrapping
Das Bootstrapping-Problem betrifft in der Philosophie nicht nur die Epistemologie (Erkenntnistheorie), sondern auch die Rationalität, wie unter anderen Benjamin Kiesewetter in "The Normativity of Rationality" oder Niko Kolodny in "Why be rational?" darstellt. Kiesewetter behandelt die Frage, ob Rationalität normativ ist, also ob es berechtigt ist, Menschen zu kritisieren, wenn sie irrational sind oder handeln. Hierfür dient ihm als Argument, dass es als Kritik aufgefasst wird, wenn man als "irrational" bezeichnet wird. (Das ist eigentlich für sich in der Vorgehensweise schon ein eigenes Bootstrapping-Problem.)
Rationalität betrifft wiederum mindestens zwei verschiedene Bereiche, zu denen wir verpflichtet sein können: Es gibt die instrumentelle Rationalität nach dem Muster: Wer die den Zweck will, muss auch die Mittel dazu wollen. Daneben gibt es noch die Rationlität im Sinne einer Widerspruchsfreiheit: Wenn man glaubt, dass es am Ort x zur Zeit y regnet, dann glaubt man nicht, dass es am Ort x zur Zeit y nicht regnet. Man glaubt p und nicht, dass p falsch ist, jedenfalls nicht zur gleichen Zeit. Man ist in diesem Fall also dazu verpflichtet, nicht an Widersprüchliches zu glauben.
Über diese Unterscheidung hinaus gibt es zwei verschiedene Lesarten der Normativität Rationalität: wide-scope und narrow-scope
- Wide-scope: Man ist rational dazu verpflichtet, zu glauben, dass es nicht regnet, wenn man glaubt, dass es nicht regnet.
- Narrow-scope: Wenn man glaubt, dass es nicht regnet, ist man rational dazu verpflichtet, zu glauben, dass es nicht regnet.
Im ersten Fall handelt es sich um ein Konditional zu dem man verpflichtet ist - per Rationalität. Logisch löst man ein Konditional (also eine Wenn-Dann-Aussage) dadurch auf, dass man aus einem "Wenn A, dann B" beispielsweise eine Disjunktion macht, also "Nicht A oder B", was logisch äquivalent ist. Oder man macht daraus eine Konjunktion: "Nicht( A und Nicht B)". Und in der wide-scope-Lesart ist dies möglich, da diese logischen Umformungen innerhalb der rationalen Verpflichtung stattfinden. Man ist also dazu verpflichtet, widersprüchliche Aussagen zu vermeiden, bzw. eine falsche Annahme oder eben ihre Negation aufzugeben.
Im zweiten Fall befindet sich die rationale Verpflichtung im Konsequenz. Wenn man glaubt, dass es nicht regnet, so ist man dann rational verpflichtet, zu glauben, dass es nicht regnet. Aus einem Glauben - ganz gleich, wie er zustande gekommen ist - resultiert also eine rationale Verpflichtung.
Kommt man durch eine geistige Verwirrung zu irgendeiner komischen Annahme Q, so verlangt dann eine narrow-scope-Lesart der Normativität der Rationalität, dass die Negation der komischen Annahme abgelehnt wird. Man erhält also aus einer komischen Annahme Q durch diese narrow-scope-Lesart einen zusätzlichen Grund, die Rationalität, diese komische Annahme Q zu glauben. Das ist dann Bootstrapping in der Normativität der Rationalität.
Wenn man Bootstrapping ernstnimmt und vermeiden möchte, aber zum Schluss kommt, dass nicht nur die narrow-scope-Lesart, sondern auch die wide-scope-Lesart zum Bootstrapping-Problem führt, so hat das die vielleicht problematische Konsequenz, dass Rationalität nicht normativ ist. Also könnte man Irrationalität nicht mehr kritisieren.
Literatur: Benjamin Kiesewetter, The Normativity of Rationality, Oxford 2017. Jonathan Weisberg, The Bootstrapping Problem, 2012. Niko Kolodny, Why Be Rational?, 2005. http://www-cs.stanford.edu/~epacuit/classes/rationality-fall2010/kolodny-whyberational.pdf