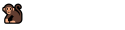Das Münchhausen-Trilemma: Woher wissen wir, dass die Erde keine Scheibe ist?
Dass die Erde keine Scheibe ist, wird in der Bevölkerung zweifellos angenommen. Doch nicht jeder sieht das so (Flach-Erdler). Welche Gründe gibt es, daran zu zweifeln? Woher wissen wir eigentlich irgendetwas?
Münchhausen-Trilemma
Seit mindestens 1.900 Jahren wird thematisiert, ob wir etwas wissen können. Der Bezug zu Münchhausen stammt vom Philosophen Hans Albert, der meinte, dass wir bei jedem "Wissen" auf eines von drei Problemen stoßen müssen:
- Wir behaupten eine Aussage und müssen sie begründen, doch erfordert auch dieser Grund selbst einen Grund, welcher ebenfalls begründet werden muss. Letztendlich kommt man auf keinen festen Grund, da alles zu begründen ist. Das nennt er Infiniten Regress.
- Begründete man nicht alles, so stünde die eigene Behauptung nicht auf gesichertem Wissen. Wer kann schon Konklusionen für wahr halten, wenn er Prämissen nicht für wahr halten kann? Bricht man den infiniten Regress einfach ab, so spart man sich unendlich viel Arbeit, steht allerdings mit leeren Händen da - außer eben mit ungesicherten Annahmen.
- Einen scheinbaren Ausweg bieten Zirkelschlüsse: Auch hier kann man unendlich viel Zeit verbringen, muss man aber nicht. Am Ende steht man allerdings auch hier mit leeren Händen da. Man begründet eine Annahme, oder vielleicht sogar eine Annahme einer Annahme mit einem Grund, der letztlich die ursprüngliche Annahme selbst ist. Man erhält eine Prämisse, die sich selbst stützt. Damit hat man auch gleich die hohe Kunst des Barons selbst gemeistert: Man zieht sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf, während man bei den anderen Problemen baden geht.
Beispiele
Wir haben die Annahme, dass es einen Gott gibt, den einen christlichen Gott sogar. Fragen wir nach einem Grund, so könnten wir einen Verweis auf die Bibel erhalten: Dort ist die Rede von einem solchen Gott. Damit ist die erste Annahme gestützt. Doch warum ist etwas wahr, wenn es in der Bibel steht? Eine von unendlich vielen Antworten könnte lauten: "Gott hätte keine Lügen in dem Buch der Bücher zugelassen." Dabei stützt die Annahme der Annahme sich selbst auf die Annahme, die sie stützen soll. Wenn Gott existiert, weil er in der Bibel erwähnt wird, und die Bibel wahr ist, weil Gott sie nicht unwahr hätte werden lassen, so existiert ein Gott, weil er existiert. Dabei erhalten wir den Zirkelschluss.
Wenn wir die Annahme haben, dass die Erde rund ist, wie durchaus noch vereinzelt bezweifelt wird, müssen wir sie auch begründen. Wir können uns fragen, ob die Bilder, die eine runde Erde zeigen, als Grund reichen. Natürlich muss das nicht reichen und für eine absolute Gewissheit darf kann das nicht reichen. Die Bilder könnten gefälscht sein. Warum sollten wir annehmen, dass sie nicht gefälscht sind? Weil kein Mensch, den wir ernst nehmen glaubt, sie seien gefälscht. Doch soll das ein Grund sein? Können nicht alle Menschen irren? Warum sollte man das glauben? Ein solches Gespräch würde man gerne abbrechen, doch man muss zugeben, dass man nicht auf sicherem Grund angekommen ist. Unser Wissen bezüglich der Rundheit der Erde ist nicht gesichert, jedenfalls nicht so sehr wir es gerne praktischerweise annehmen. Bräche man ein solches Gespräch nicht ab, würde man ewig im infiniten Regress stecken.
Doch was ist mit der Logik bzw. der Mathematik? Ganz gleich, was wir empirisch wahrnehmen, unsere mathematischen Aussagen ändern sich dadurch nicht, könnte man meinen. Doch auch in der Mathematik braucht man Axiome, man braucht Konventionen und Annahmen. Ein logisches System muss in sich selbst schlüssig sein, doch einen Bezug darüber hinaus zur Realität braucht es nicht – und von der Realität außerhalb der Logik können wir nichts sagen. Im Übrigen kann man sich fragen, ob es nicht vielmehr unsere eigene Psychologie ist, die ein unnötiges Bedürfnis nach Kausalität und Logik hat. Unsere Logik lässt sich psychologisch erklären und kann damit auf einer ganz anderen Grundlage weitere Fragen nach Gründen hervorrufen.
Lösung
Eine Lösung kann und darf man wohl nicht versprechen, allerdings gibt es mindestens zwei Möglichkeiten mit diesem Thema umzugehen:
Dogmatisch sein oder Traditionen folgen
Man kann einfach an einem gewissen Punkt aufhören, die eigenen Annahmen zu überprüfen und stattdessen dogmatisch auf einem Punkt verharren. Beliebt ist dies bei sensiblen Themen wie Ernährung, Politik oder dem Glauben. Wer glaubt und am Ende eines jeden Hinterfragens die Antwort Gott bietet, der macht aus einer Annahme eine Antwort. Nimmt man "Gott" an und hinterfragt nicht weiter, hat man seinen Frieden und für sich vielleicht festen Grund, doch in der Perspektive der Mitmenschen geht der Gläubige vielleicht gerade baden. Dabei ist es sogar egal, ob der Gläubige an eine runde Erde oder einen alten Mann mit Bart in den Wolken glaubt.
Streng genommen folgt man mit dem Glauben einer Denktradition, die in sich kohärent aufgebaut ist und keine Probleme versursacht. Es gibt viele Denktraditionen, u.a. solche, wie man sie in den Naturwissenschaften vorfindet. Dort hinterfragt man eher selten, ob mathematische Methoden überhaupt eine Berechtigung haben. Man zieht nicht alles unendlich in Zweifel. Annahmen können praktisch und nützlich sein. Man könnte sonst sogar an der eigenen Existenz zweifeln oder auf die Idee kommen, dass man nicht real ist, oder die Welt es nicht ist.
Im Übrigen ist ein Denken außerhalb einer Tradition unmöglich, wie schon Paul Feyerabend wusste.