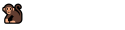Arthur Schopenhauers Charakterlehre
Einigen Menschen wird ein guter Charakter zugeschrieben, anderen ein schlechter. Urteile wie diese scheinen stets bedeutsamer und grundsätzlicher zu sein als Urteile über das Äußere, Urteile über einzelne Handlungen oder etwa Urteile über das geistige Vermögen. Denn was scheint einem Menschen mehr anzuhängen auf der Reise zwischen Geburt und Tod als der eigene Charakter, während anderes zu kommen und zu gehen vermag?
Doch mit dieser Einschätzung allein ist der Begriff „Charakter“ nicht greifbar. Eine moderne Definition liefert der US-amerikanische Soziologe Amitai Etzioni definiert „Charakter“ so:
„We mean by character the psychological muscles that allow a person to control impulses and defer gratification, which is essential for achievement, performance, and moral conduct.“[1]
Dieser modernen Definition nach ist also unser Vermögen, uns zu disziplinieren, der Charakter. Charakterstarke Menschen müssten demnach mehr in der Lage sein, auf eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zu verzichten und ihr langfristiges, vielleicht größeres, Wohl anzuvisieren. Zudem schafft ein solcher Charakter die Möglichkeit, vor einer Handlung ethische Folgen dieser abzuwägen und entsprechend der ethischen Konsequenzen, falls notwendig, anders zu handeln. Damit scheint der Charakter zentral für das eigene Glück, die eigene Moralität und dadurch sicherlich auch für die Meinung Anderer von uns zu sein.
Über diese moderne Definition gehen solche aus dem 18. und 19. Jahrhundert hinaus. Der Charakter ist zum einen die Summe von Persönlichkeitseigenschaften, zum anderen „des Pudels Kern“ eines Menschen – oder eben der Mensch an sich. So schreibt Friedrich Schiller im elften seiner Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen zum Charakter:
„Person und Zustand – das Selbst und seine Bestimmungen – die wir uns in dem nothwendigen Wesen als Eins und Dasselbe denken, sind ewig Zwei in dem endlichen. Bei aller Beharrung der Person wechselt der Zustand, bei allem Wechsel des Zustands beharret die Person. Wir gehen von der Ruhe zur Thätigkeit, vom Affekt zur Gleichgültigkeit, von der Uebereinstimmung zum Widerspruch; aber wir sind doch immer, und was unmittelbar aus uns folgt, bleibt. In dem absoluten Subjekt allein beharren mit der Persönlichkeit auch alle ihre Bestimmungen, weil sie aus der Persönlichkeit fließen. Alles, was die Gottheit ist, ist sie deßwegen, weil sie ist, sie ist folglich alles auf ewig, weil sie ewig ist.“[2]
Damit kommt dem Charakter eine noch größere Bedeutung als in der modernen Definition zu. Der Charakter ist nicht bloß ein Vermögen, sondern das Wesen des Menschen.
Da nun davon ausgegangen werden kann, dass der Charakter eine große Bedeutung hat, stellt sich natürlich die Frage, wie man zu einem guten Charakter kommt. Schafft die Erziehung einen guten Charakter? Ist er angeboren? Und vor allem: Ist der Charakter veränderlich? Können Menschen sich bessern? Oder kann man wenigstens, wie Schiller, Charaktere veredeln?
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Charakterlehre von Arthur Schopenhauer. Dabei soll sowohl dargelegt werden, welchen Charakterbegriff er hat, als auch gezeigt werden, wie er diese Fragen beantwortet. Welche Argumente liefert Schopenhauer für seine Charakterlehre?
Eingeordnet wird die Charakterlehre Schopenhauers durch eine Darstellung der Charakterlehre Kants, auf welcher er aufbaute, und durch den Blick auf die Wirkung seiner Charakterlehre auf andere Denker.
Inhalt
- Ursprung der Schopenhauerschen Charakterlehre.
- Charakterlehre in Schopenhauers System
- Rezeption der Schopenhauerschen Charakterlehre
- Fazit
Ursprung der Schopenhauerschen Charakterlehre
Kant
Die dritte Antinomie
Arthur Schopenhauers Charakterlehre basiert auf der Immanuel Kants, wie er im Anhang des ersten Bandes seines Hauptwerkes Die Welt als Wille und Vorstellung schreibt:
„Die Auflösung der dritten Antinomie, deren Gegenstand die Idee der Freiheit war, verdient eine besondere Betrachtung, sofern es für uns sehr merkwürdig ist, daß Kant vom Ding an sich, das bisher nur im Hintergrunde gesehen wurde, gerade hier, bei der Idee der Freiheit, ausführlicher zu reden genöthigt wird. Dies ist uns sehr erklärlich, nachdem wir das Ding an sich als den Willen erkannt haben. Ueberhaupt liegt hier der Punkt, wo Kants Philosophie auf die meinige hinleitet, oder wo diese aus ihr als ihrem Stamm hervorgeht.“ (Deu-I:595)
Daher muss nun der Fokus zunächst auf Kants dritter Antinomie der reinen Vernunft und darauffolgend auf der Charakterlehre liegen.
Die Antinomien der reinen Vernunft sind vier Paare von einander widersprechender Antworten (These und Antithese) auf Fragen, die die Vernunft fordern – oder mit Kants Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft gesprochen: „belästigen“. Jede (Anti-) These ist ein Schluss a priori. Die dritte Antinomie beschäftigt sich mit dem Gegensatz von Kausalität aus Freiheit (hier: Unabhängigkeit von weiteren Ursachen) und Naturkausalität.
Dies betrifft die Frage, ob es eine erste Ursache gibt. Folgt man einer Kette von Ursachen immer weiter zurück, so erfordert das Gesetz vom zureichenden Grund stets, dass es für jede Veränderung einen für sie hinreichenden Grund gibt. Ist die Kette von Ursachen dann unendlich (unendlicher Regress), ist sie zirkulär oder stößt man an irgendeinem Punkt auf eine Ursache, die selbst keiner weiteren Ursache bedarf?
Die These der dritten Antinomie ist:
„Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig.“ (KrV A 444-446/B 472-474)
Kant argumentiert für diese These, indem er davon ausgeht, dass ihre Negation zu einem Widerspruch führt: Sollte es nicht möglich sein, dass Kausalität aus Freiheit folgt, so müsste eine Reihe von Ursachen unendlich sein. Damit könnte man allerdings nicht a priori Ursachen bestimmen. Ohne Kausalität aus Freiheit, oder einer nicht naturkausal verursachten Ursache könnte man nach Kant nicht a priori hinreichend die Ursachen angeben. Der Kern des Kausalitätsbegriffes besteht, so Kant, aber genau darin, dass a priori die Ursachen bestimmbar sein müssen. Die Negation der These, dass es notwendig ist, Kausalität aus Freiheit anzunehmen, führe also zu einem Widerspruch (KrV A 446/B 474).
Kants Antithese dieser dritten Antinomie lautet:
„Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur“ (KrV A 445/B 473)
Diese Antithese belegt Kant, indem er zeigt, dass ihr Gegenteil, also die Annahme von Freiheit, Unbedingtheit als eine besondere Art von Kausalität zu einem Widerspruch führt. Kant nimmt nämlich an, dass in der Natur jedes Ereignis einen vorigen Zustand voraussetzt. Eine Kausalität aus Freiheit aber muss kausal völlig unabhängig von einem vorigen Zustand sein. Die Kausalität hat nach Kant für alle Ereignisse in der Welt Gültigkeit. Damit kann es keine Kausalität aus Freiheit bzw. Spontanwirkungen geben.[3]
Zentral scheint für Kant aber vor allem zu sein, dass das Prinzip der Kausalität die „gesetzmäßige Einheit der Erfahrung verspricht“ (KrV A 449/B 477), während Freiheit in ebendieses konstitutive Element der Erfahrung eingreift und daher in ihr nicht vorgefunden werden kann. Es ist ihm „ein leeres Gedankending.“ (KrV A 449/B 477)
Also steht es um die dritte Antinomie so: Es muss Freiheit geben, da es sonst eine unendliche Kausalkette geben muss, die nicht hinreichender Grund für eine Veränderung sein kann. Und es kann keine Freiheit oder unbedingte/spontane Veränderung geben, da das Kausalitätsprinzip uneingeschränkt gilt.
Der Fehler im Widerspruch der dritten Antinomie liegt nach Kant darin, den Begriff „Welt“ für die Welt an sich zu nehmen und ihn für bestimmt zu halten. In den Antinomien fehle die Unterscheidung zwischen „Ding an sich“ und „Erscheinung“. Die Thesis behandelt nach Kant den Bereich der Dinge an sich, während die Antithesis den Bereich der Erfahrung der Erscheinungen behandelt (KrV A 537 f./B 565 f.).
Die dritte Antinomie ist also dadurch aufzulösen, dass die Freiheit und die Erfahrung getrennt werden. Die Erfahrung mit ihren Formen, Raum und Zeit, ist notwendig geprägt durch die Kausalität (KrV A 534/B 562), welcher die Freiheit widerspricht, dazu enthält die Freiheit als eine rein transzendentale Idee „nichts von der Erfahrung Entlehntes“ (KrV A 534/B 562). Die Freiheit ist eine Idee der Vernunft, die die von der Kausalität komplett beherrschten Natur (Erscheinungen) erkennt: Spontan ohne vorherige Ursache etwas zu verursachen und damit eine Kausalkette zu beginnen, soll sie können.
Die offensichtliche Frage bei dieser Unterscheidung ist, ob aus der Freiheit Handlungen bewirkt werden können, die von der Naturkausalität abweichen, sodass doch wieder ein Widerspruch auftritt, oder durch die innere Freiheit bloß Handlungen verursacht werden können, die auch durch die Naturkausalität notwendig sind, wodurch die Freiheit kausal irrelevant werden würde. Der Ausweg Kants ist die Unterscheidung zwischen intelligibel und empirisch. Ein Gegenstand ist nun von zwei Seiten aus zu betrachten, ebenso wie seine Kausalität. Zum einen gibt es die Seite der Erscheinung als Gegenstand der Sinne, in welcher die Kausalität in ihrem eigentlichen Begriff gilt, und von Kant „sensibel“ genannt wird. Zum anderen gibt es die Kausalität, die selbst nicht in der Erscheinung ist. Diese ist „intelligibel“ und nicht sensibel. Diese intelligible Kausalität kann außerhalb der naturgesetzlichen Kausalität, außerhalb der Erscheinungen spontan wirken und damit Wirkungen in der Sinneswelt verursachen (KrV A 538f./B 566f.).
Also kann die außerzeitliche Freiheit lediglich Handlungen verursachen, die auch naturkausal erforderlich sind, während zugleich die kausale Relevanz der Freiheit gegeben ist, da Ursache der Handlungen in der Welt der Erscheinungen intelligibel ist.
Kants Charakterlehre
Einem Subjekt weist Kant damit auch zwei Charakter zu: einen empirischen und einen intelligiblen. Der empirische Charakter findet sich in der Welt der Erfahrungen kausal und raumzeitlich eingebunden wieder. Seine Handlungen widersprechen diesem Naturgesetz nicht.
Der intelligible Charakter, als welcher man ebendieses Subjekt von der anderen Seite aus betrachten kann, verursacht diese Handlungen in der Sinneswelt, untersteht aber nicht den Bedingungen und Gesetzen der Erfahrungswelt nicht. Das heißt, dass für den intelligiblen Charakter weder Raum, Zeit noch die Kausalität gelten. Dieser intelligible Charakter unterliegt keiner Veränderung, welche schließlich Zeit erfordern würde, und er könnte nicht unmittelbar erkannt oder wahrgenommen werden (KrV A 538f./B 566f.).
Der Mensch ist also insofern ein frei handelndes Wesen, als er eben als zwei Charaktere zu definieren ist, von denen der eine, der intelligible Charakter, frei und unabhängig von der Naturkausalität ist. Als raumzeitlich und kausal gebunden (d.h. unfrei) ist der Mensch zu betrachten wegen des empirischen Charakters, welcher Ausdruck des intelligiblen Charakters ist. Der empirische Charakter ist der wahrnehmbare Anteil des Menschen, der intelligible ist nicht unmittelbar wahrnehmbar, weder für den Menschen selbst noch für seine Mitmenschen. Der intelligible Charakter ist, was der Mensch an sich ist. Sowohl die allgemeine Frage, wie der Mensch charakterlich ist, als auch die speziellere Frage, was der Mensch eigentlich ist, bleibt notwendig offen, da dies nicht im Bereich der Sinneswelt liegt.[4]
Als Indiz für diese Unterteilung liefert Immanuel Kant dieses ein Beispiel: Lügt ein erwachsener Mensch boshaft, so kann man eine Kette von Ursachen aufstellen, die sein schlechtes Verhalten erklärt. Diese Tat kann man kausal einordnen, in dem man dieses Menschen schlechten Umgang oder schlechte Erziehung ergründet. Nach einer boshaften Tat kann man, mit genügend Informationen, leicht rückwirkend darlegen, wie es nur dazu kommen konnte. Besser noch: Man kann darlegen, wieso es zu ebendieser Tat zu ebendiesem Zeitpunkt kommen musste. Man glaubt daran, dass es in dieser Welt mit rechten Dingen und kausal zugeht, und zeichnet Pfade der Kausalität von der Kindheit – am besten noch der Kindheiten der Eltern – bis hin zu dieser Tat, deren empirische Bedingungen man alle schließlich kennt.[5]
Und dennoch wird diese Reihe von Bedingungen, diese Kausalkette beiseite gewischt und von dem erwachsenen Menschen ein dieser Naturkausalität entgegenstehendes Verhalten verlangt. Worauf kann man sich berufen? Man beruft sich, so Kant, auf die Vernunft, die man nicht als Konkurrent zu dieser Kausalkette betrachtet, sondern als allein und vollständig verantwortlich. Man beruft sich auf eine Kausalität aus Freiheit, darauf eben, dass der intelligible Charakter diese Tat des zeitlichen empirischen Charakters verursacht hat. Wenn man „hätte anders handeln können“ sagt, so meint man nach Kant stets, dass die Handlung nicht rein naturkausal verursacht ist, sondern eben kausal aus Freiheit, und dass die Vernunft die Macht über Handlungen hatte (KrV A 554f./B 582f.).
Unklar bleibt für Kant, warum und wie der intelligible Charakter welche Erscheinungen und welchen empirischen Charakter verursacht. Dies liegt, so Kant, außerhalb des Vermögens der Vernunft. Fest steht, dass in Einklang mit seiner Auflösung der dritten Antinomie Freiheit und Naturkausalität parallel bestehen und „letztere die erstere nicht affiziere“ (KrV A 557/B 585).
Neben der Unterscheidung zwischen intelligiblen und empirischen Charakter trennt Kant auch noch den physischen vom moralischen Charakter. Ersterer ist Naturell und Temperament. Letzterer ist die Denkungsart oder der Charakter schlechthin. Dieser moralische Charakter ist zeitlich, da er sich erwerben lässt und ist damit auch, wie der physische Charakter, dem empirischen Charakter zuzuordnen. Einen moralischen Charakter hat man, wenn man sich an bestimmte praktische Prinzipien (Maximen) bindet, die man sich durch die eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrieben hat.[6]
Schopenhauers Kritik an Kants Auflösung der dritten Antinomie
Begriff der Welt
Wenn Kant schreibt, „alles in der Welt geschieht lediglich nach den Gesetzen der Natur“, so meint er die empirische Welt. Anders ist die Antithese nicht zu verstehen, da Kant sich die Kausalität sonst in den Bereich holen würde, in welchem er sie nicht haben will: den des Dings an sich. Dagegen stellt sich die Frage, wovon Kant in der These spricht: Geht es hier um Dinge an sich oder um Gegenstände der Sinne? Schopenhauer meint (im Gegensatz zu den Ausführungen oben), dass auch diese These sich auf die Erscheinungen – bzw. in seiner Sprache – die Welt als Vorstellung bezieht:
„Ferner wird der vorgesetzte Zweck, die Auflösung der dritten Antinomie, durch die Entscheidung, daß beide Theile, jeder in einem andern Sinne, Recht haben, gar nicht erreicht. Denn sowohl Thesis als Antithesis reden keineswegs vom Dinge an sich, sondern durchaus von der Erscheinung, der objektiven Welt, der Welt als Vorstellung.“ (Deu-I:600.)
Sinnvoll ist Schopenhauers Einwand hier nur, wenn man davonausgeht, dass er sich auf Kants Auflösung bezieht und dessen Zuordnung der Freiheit zum Ding an sich kritisiert. Vor Kants Auflösung ist die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich noch gar nicht getroffen. Wie nachfolgend zu sehen, ist die Kritik an dem Begriff der Welt von nur geringer Bedeutung.
Gegen die Argumentation der These der dritten Antinomie
Immanuel Kant begründet die These der dritten Antinomie, nämlich, dass es Kausalität aus Freiheit geben müsse, damit, dass man ohne Freiheit einen infiniten Regress haben müsse. Dieser würde verhindern, dass man von irgendeiner Veränderung vollständig benenne, was für sie hinreichend sei (KrV A 446/B 474).
Das ist für Arthur Schopenhauer eine zu große Einschränkung:
„Es will die Endlichkeit der Reihe der Ursachen daraus beweisen, daß eine Ursache, um zureichend zu seyn, die vollständige Summe der Bedingungen enthalten muß, aus denen der folgende Zustand, die Wirkung, hervorgeht. Dieser Vollständigkeit der in dem Zustand, welcher Ursach ist, zugleich vorhandenen Bestimmungen schiebt nun das Argument die Vollständigkeit der Reihe von Ursachen unter, durch die jener Zustand selbst erst zur Wirklichkeit gekommen ist: und weil Vollständigkeit Geschlossenheit, diese aber Endlichkeit voraussetzt, so folgert das Argument hieraus eine erste, die Reihe schließende, mithin unbedingte Ursache. Aber die Taschenspielerei liegt am Tage. Um den Zustand A als zureichende Ursache des Zustandes B zu begreifen, setze ich voraus, er enthalte die Vollständigkeit der hiezu erforderlichen Bestimmungen, durch deren Beisammenseyn der Zustand B unausbleiblich erfolgt. Hiedurch ist nun meine Anforderung an ihn als zureichende Ursache gänzlich befriedigt und sie hat keine unmittelbare Verbindung mit der Frage, wie der Zustand A selbst zur Wirklichkeit gekommen sei: vielmehr gehört diese einer ganz anderen Betrachtung an, in der ich den nämlichen Zustand A nicht mehr als Ursache, sondern selbst wieder als Wirkung ansehe, wobei ein anderer Zustand sich zu ihm wieder eben so verhalten muß, wie er selbst sich zu B verhielt.“ (Deu-I:590)
Für Schopenhauer reicht es bereits, zu sagen, dass Veränderung A hinreichend für Veränderung B ist, ohne das Wissen um alle Bedingungen und Bedingungen von Bedingungen von A kennen zu müssen. Kants Annahme bzw. hohe Forderung an die Nennung von Bedingungen verwirft er. Damit ist die These der dritten Antinomie nach Schopenhauer nicht ausreichend begründet. Seiner Ansicht nach steht nur die Antithese dieser Antinomie: „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.“ (KrV A 445/B 473)
Kausalität außerhalb der Sinneswelt
Es ist stets die Rede von „Kausalität aus Freiheit“ (KrV A 444f./B 472f.). Dies scheint die Möglichkeit zu implizieren, dass es in der empirischen Welt irgendeine Kausalkette gibt, deren empirischer Anfang eine Ursache hat, die außerhalb der empirischen Welt liegt – bzw. vereinfacht, dass es Kausalketten in der Welt der Erscheinungen gibt, die einfach anfangen. Dies ist der ganze Punkt des Beweises der These von Kant.
Damit muss es jenseits der Welt der Erscheinungen, jenseits der Kausalität Dinge, wie eben den intelligiblen Charakter geben, der Dinge beginnt, die dann schließlich in der empirischen Welt fortlaufen. Hierzu schreibt Kant zum einen:
„Zweitens würde man ihm noch einen intelligiblen Charakter einräumen müssen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht, und selbst nicht Erscheinung ist.“ (KrV A 540/B 568)
Damit wäre etwas außerhalb der empirischen Welt Ursache. Zum anderen heißt es allerdings eine Seite später:
„Man würde von ihm [dem Subjekt] ganz richtig sagen, daß es seine Wirkungen in der Sinneswelt von selbst anfange, ohne daß die Handlung in ihm selbst anfängt; und dieses würde gültig sein, ohne daß die Wirkungen in der Sinneswelt darum von selbst anfangen dürfen, weil sie in derselben jederzeit durch empirische Bedingungen in der vorigen Zeit, aber doch nur vermittelst des empirischen Charakters (der bloß die Erscheinung des intelligiblen ist), vorher bestimmt, und nur als eine Reihe der Naturursachen möglich sind. So würde denn Freiheit und Natur, jedes in seiner vollständigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen, nachdem man sie mit ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Widerstreit angetroffen werden.“ (KrV A 541/B 569)
Damit ist nicht notwendig klar, wie Kant sich das vorstellt, wohl aber, dass die nachfolgende Kritik von Schopenhauer nicht ganz zutrifft:
„Denn, durch Nachforschung einer unbedingten Ursache gefunden, tritt hier der Wille, oder das Ding an sich, zur Erscheinung in das Verhältniß der Ursache zur Wirkung. Dieses Verhältniß findet aber nur innerhalb der Erscheinung Statt, setzt diese daher schon voraus und kann nicht sie selbst mit dem verbinden, was außer ihr liegt und toto genere von ihr verschieden ist. […] Wenn von Ursach und Wirkung geredet wird, darf das Verhältniß des Willens zu seiner Erscheinung (oder des intelligibeln Charakters zum empirischen) nie herbeigezogen werden, wie hier geschieht: denn es ist vom Kausalverhältniß durchaus verschieden. […] Also liegt das Recht ganz auf der Seite der Antithese […]“ (Deu-I:600 f.)[7]
Die genaue Beziehung zwischen dem empirischen und intelligiblen Charakter bei Kant scheint nicht ganz klar zu sein. Es spricht viel dafür, dass Kant die Beziehung wirklich als kausal betrachtet, wie KrV A 540/B 568 und auch KrV A 557/B 585 zeigen. Nach Schopenhauer (ab 1818) kann es dagegen keine kausale Beziehung zwischen dem Ding an sich und der Erscheinung bzw. den beiden Charakteren geben.
Ort der Motive
Zur Verteidigung der Thesis, dass es Kausalität aus Freiheit gebe, führt Kant an:
„Denn wir reden hier nicht vom absolut ersten Anfange der Zeit nach, sondern der Kausalität nach. Wenn ich jetzt (zum Beispiel) völlig frei, und ohne den notwendig bestimmenden Einfluß der Naturursachen, von meinem Stuhle aufstehe, so fängt in dieser Begebenheit, samt deren natürlichen Folgen ins Unendliche, eine neue Reihe schlechthin an, obgleich der Zeit nach diese Begebenheit nur die Fortsetzung einer vorhergehenden Reihe ist.“ (KrV A 450/B 478).
Es gibt wahrscheinlich kaum ein besseres Beispiel, um Kants dritte Antinomie zu illustrieren. Fängt mit Kants Aufstehen vom Stuhl eine neue Kausalreihe aus Freiheit an? Ist Kants Aufstehen ohne Ursache in der Welt der Erscheinungen? Schopenhauer verneint dies im Anhang seines Hauptwerkes 1818:
„Zur Erläuterung der Behauptung dieser falschen Thesis entblödet sich Kant nicht, in der Anmerkung zu derselben, sein Aufstehen vom Stuhl als Beispiel eines unbedingten Anfangs zu geben: als ob es ihm nicht so unmöglich wäre, ohne Motiv aufzustehen, wie der Kugel ohne Ursache zu rollen.“ (Deu-I:591)
In der zweiten Auflage seiner Dissertation schreibt Schopenhauer dazu 1847:
„Hier stehn wir gleichsam hinter den Koulissen und erfahren das Geheimniß, wie, dem innersten Wesen nach, die Ursach die Wirkung herbeiführt: denn hier erkennen wir auf einem ganz andern Wege, daher in ganz andrer Art. Hieraus ergiebt sich der wichtige Satz: die Motivation ist die Kausalität von innen gesehn.“ (Deu-III:253)
Damit ist Kants Aufstehen für Schopenhauer spätestens seit 1818 verursacht durch eine Veränderung in der empirischen Welt.[8]
Ding an sich: Vernunft oder Wille
Bei aller Kritik Schopenhauers an Kants dritter Antinomie, sieht Schopenhauer in dieser Arbeit eine der, wenn nicht die größte Leistung Kants:
„Diese Lehre Kants vom Zusammenbestehen der Freiheit mit der Nothwendigkeit halte ich für die größte aller Leistungen des menschlichen Tiefsinns.“ (Deu-III:646)
Und aus dieser Arbeit ergibt sich nicht bloß die Charakterlehre Kants, sondern ebenso die große Vorarbeit für Schopenhauers Charakterlehre. An dieser Stelle soll nun schon ein zentraler Unterschied der beiden Charakterlehren thematisiert werden, da dieser im Kontext der bereits genannten Kritikpunkte Schopenhauers an Kant steht – also ebenso 1818. Es geht um Kants „Tür“ zur praktischen Vernunft als absolute Spontanität:[9]
„Als dieses Ding an sich wird für diesen Fall des Menschen Wille (den Kant höchst unstatthaft, mit unverzeihlicher Verletzung alles Sprachgebrauchs, Vernunft betitelt) aufgestellt, mit Berufung auf ein unbedingtes Sollen, den kategorischen Imperativ, der ohne Weiteres postulirt wird.“ (Deu-I:599)
Schopenhauer sieht bei Kant zum einen die (im Rahmen dieser Arbeit weniger bedeutsamen) historische Vertauschung der Begriffe „Verstand“ und „Vernunft“ und zum anderen betrachtet er es als falsch, dass das Ding an sich die kantische Vernunft ist. Für ihn ist dies der Wille,[10] der (insbesondere in seinen Schriften ab 1818) unvernünftig ist. Damit ist „Willensfreiheit“ auch nicht ein per se positiver Begriff.
Platon und Indien – oder: Kant plus Kunst
Welche Rolle spielt Platon für die Charakterlehre von Arthur Schopenhauer? Neben dem „erstaunlichen“ (Deu-III:3) Kant, mit dem er sich lange auseinandergesetzt hat, und dem „großen“ (Deu-I:455) Goethe, der kaum einen Zeitgenossen nicht zu seinen Bewunderern zählen durfte, hatte Schopenhauer stets größte Achtung vor dem „göttlichen“ (Deu-III:3) Platon. Dass die Philosophie Platons in die Schopenhauersche einging, wird aus seinem handschriftlichen Nachlass von 1814, also der Zeit der Entwicklung seiner Philosophie, sichtbar:
„Meine Philosophie soll von allen bisherigen (die Platonische gewissermaaßen ausgenommen) sich im innersten Wesen dadurch unterscheiden daß sie nicht, wie jene alle, eine bloße Anwendung des Satzes vom Grunde ist und an diesem als Leitfaden daher läuft, was alle Wissenschaften müssen, daher sie auch keine seyn soll, sondern eine Kunst.“ (HNI:126)
Ebenso zeigt dieses Zitat, dass er seine Philosophie nicht als eine Wissenschaft, oder wenigstens nicht bloß als eine solche verstanden haben will, sondern als etwas darüber hinaus. Seine Philosophie soll sich nicht darauf beschränken, was Kants Welt der sinnlichen Gegenstände ist, nicht auf die Erscheinungen, nicht auf die Welt als Vorstellung, für welche Raum, Zeit und Kausalität gilt, und auf welche (Natur-) Wissenschaften beschränkt sind. Seine Philosophie sollte also über das Gebiet seiner Dissertation, der Gegenstände, die unter den Satz des zureichenden Grundes fallen, hinausgehen.
Damit meinte Schopenhauer zu dieser Zeit auch noch seine Methoden des Erkenntnisgewinns, die nie genauer dargestellt oder erläutert wurden, und die darüber hinaus auch nur besonderen Menschen, wie etwa künstlerischen Genies (z.B.: Goethe) und Heiligen zur Verfügung stehen. So schreibt Schopenhauer zwischen 1807 und 1811, dass der göttliche Platon die Ideen direkt angeschaut hat, während Kant diese Kontemplation nicht gekannt hat[11] und mit der Kritik der reinen Vernunft den Selbstmord der Philosophie betrieben hat.
Das Verhältnis der von ihm Verehrten zeigt diese Passage:
„Einer erzählt eine Lüge: ein andrer, der die Wahrheit weiß, sagt, dies ist Lug und Trug, und hier habt ihr die Wahrheit. Ein Dritter, der die Wahrheit nicht weiß, aber sehr scharfsinnig ist, zeigt Widersprüche und unmögliche Behauptungen in jener Lüge auf und sagt: darum ist es Lug und Trug. Die Lüge ist das Leben, der Scharfsinnige ist allein Kant, die Wahrheit hat mancher mitgebracht, z.B. Plato. Wäre nicht mit Kant zu gleicher Zeit Goethe der Welt gesandt, gleichsam um ihm das Gegengewicht im Zeitgeist zu halten, so hätte jener auf manchem strebenden Gemüt wie ein Alp gelegen und es unter großer Qual niedergedrückt, jetzt aber wirken beide aus entgegengesetzten Richtungen unendlich wohlthätig und werden den deutschen Geist vielleicht zu einer Höhe heben, die selbst das Alterthum übersteigt.“ (HNI:12 f.)
Lange noch vor der Entstehung des Hauptwerkes sieht Schopenhauer in Kant den großen Philosophen, welcher mit seiner Methode des Kritizismus scharf die Erscheinungen als solche, nämlich bloße Erscheinungen, erkennt.
„Ich habe es oben als das Hauptverdienst Kants aufgestellt, daß er die Erscheinung vom Dinge an sich unterschied, diese ganze sichtbare Welt für Erscheinung erklärte und daher den Gesetzen derselben alle Gültigkeit über die Erscheinung hinaus absprach.“ (Deu-I:514)
Doch das kantische Ding an sich bleibt Kant eben selbst verborgen, er kommt nicht dahinter. Seine Philosophie erkennt, was falsch ist, aber ist blind, wenn es um das Richtige geht. Hier kommt Platon zum Zug, und mit ihm die Upanishaden.[12]
Recht hat Schopenhauer nun, wenn er von Kunst spricht, wenigstens, wenn man betrachtet, wie er die philosophischen Konzepte vereint:
1816 setzt Schopenhauer für die Bereiche der Metaphysik, der Ästhetik und der Ethik diese drei Konzeptionen und Begrifflichkeiten zusammen. Für die Metaphysik erscheint ihm das Allgemeine mittels der Gleichsetzung der Platonischen Idee, des Kantischen Ding an sich und der Weisheit der Vedas (eine Art metaphysischer Ursprung allen Seins, auch „Brahm[a]“ genannt).[13] Als Einzelnes sieht Schopenhauer die Verbindung zwischen Platons Werdendem, nie Seienden, Kants Erscheinung und dem Schleier der Maja (HNI:392). Und schon ein Jahr nach der Dissertation von 1813 schreibt Schopenhauer:
„Platons Lehre daß nicht die sinnenfälligen Dinge, sondern nur die Ideen, die ewigen Formen, wirklich seyen, ist nur ein andrer Ausdruck der Lehre Kants daß die Zeit und der Raum nicht den Dingen an sich zukämen, sondern bloß Form meiner Anschauung seyen.“ (HNI:131)
Was bedeuten diese begrifflichen Gleichsetzungen für Schopenhauers Charakterlehre? Für Schopenhauer gehören alle „klassischen“ Bereiche der Philosophie zusammen. Seine Philosophie soll eine organische sein, in welcher das Ganze nicht ohne seine Teile, und seine Teile nicht ohne das Ganze bestehen können; in welcher kein Teil das erste und keines das letzte ist; und in welcher kein Teil ohne das andere Teil bestehen kann. Wie er in der Vorrede seines Hauptwerkes in der ersten Auflage von 1818 schreibt, hat er nur einen einzigen Gedanken mitzuteilen (Deu-I:XIX) und:
„Ein System von Gedanken muß allemal einen architektonischen Zusammenhang haben, d.h. einen solchen, in welchem immer ein Theil den andern trägt, nicht aber dieser auch jenen, der Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. Hingegen ein einziger Gedanke muß, so umfassend er auch seyn mag, die vollkommenste Einheit bewahren.“ (Deu-I:XIX f.)
Dieser eine Gedanke wird in der Vorrede nicht genauer spezifiziert, allerdings ist es naheliegend, davon auszugehen, dass er etwa so lautet: „Die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens.“ Oder mit dem Titel des Hauptwerkes: „Die Welt legt sich uns Menschen, als Objektivationen des Willes, als Wille und Vorstellung dar.“
Es ist also notwendig, über das eigentliche Thema des Charakters hinauszugehen.
Schopenhauer meint, dass Kant die Erscheinungen entzaubert hat, aber in seinem Denken noch nicht zum Ende gekommen ist und er daher Kant vollendet hat (Deu-I:595). In seinen Begriffen ist Kants Ding an sich nun der Wille: „Ich habe das Ding an sich, das innre Wesen der Welt, benannt nach dem aus ihr, was uns am genausten bekannt ist: Wille.“ (HNIV:143). Ebenso ist Kants Ding an sich die „intelligibele Ursache“ (Deu-I:595), die nicht Erscheinung ist.
Ebenso ist das Ding an sich als eine Platonische Idee zu betrachten. Eine Platonische Idee zeichnet sich dadurch aus, dass sie ewig und unveränderlich ist. Alles Veränderliche, was uns sinnlich gegeben ist, ist bloß Abbild einer Idee.[14]
Mit Platon kann Kants intelligibler Charakter ebenso als eine Idee betrachtet werden.[15] Das ist der Zugang zu Schopenhauers Verständnis vom (intelligiblen) Charakter: Dieser muss ewig und unveränderlich sein – auch muss er einen Bezug zum empirischen Charakter haben, nicht aber einen kausalen.
Charakterlehre in Schopenhauers System
Der Charakter in Schopenhauers Handlungstheorie
Schopenhauers Handlungstheorie 1813
Der Charakterbegriff von Schopenhauer ist ohne das Verständnis von Schopenhauers Dissertation nicht zu verstehen. Hier sind wiederum sowohl die erste als auch die zweite Auflage bedeutsam, da ein Vergleich dieser beiden den Entwicklungsprozess Schopenhauers offenbart. Die erste Auflage von Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde stammt aus dem Jahr 1813, also fünf Jahre vor der Veröffentlichung seines Hauptwerkes, Die Welt als Wille und Vorstellung. Die zweite Auflage der Dissertation stammt aus dem Jahr 1847 und zeigt, wie Schopenhauer seine erste Veröffentlichung an die ab 1813 entwickelte Willensmetaphysik angepasst hat.
Die erste Betrachtung der Handlungstheorie Schopenhauers folgt nun der ersten Auflage. Zunächst zum Ziel der schopenhauerschen Dissertation: Im Kern soll sie alle Fälle darlegen, in denen man „Warum?“ fragen kann. Der Satz vom zureichenden Grund lautet nämlich: „Nichts ist ohne Grund warum es sey.“ (Deu-III:7) Darüber hinaus ist eine von Schopenhauer gestellte Anforderung, dass die a priori erkennbare Gesetzmäßigkeit hinter jeder Art dieses Satzes vom zureichenden Grund gezeigt wird. (Deu-III:7)
Die erste Wurzel behandelt „die erste Klasse der Objekte für das Subjekt und die in ihr herrschende Gestaltung des Satzes vom zureichenden Grunde.“ Es geht um die Vorstellungen, die Kants „objektive reale Welt“, also die empirische Welt, welche nach Schopenhauer ohne Raum, Zeit und Kausalität nicht denkbar ist. Der Verstand erzeugt die Synthese aus den Anschauungsformen Raum und Zeit. Ebenso erzeugt er das Prinzip vom zureichenden Grund des Werdens, also die Kausalität und damit die Beziehungen von Veränderungen zueinander. Es geht in dieser Klasse also etwa darum, warum ein Stein warm wird, wenn Sonnenstrahlen auf ihn treffen.
Die zweite Klasse beinhaltet die Vorstellungen der Begriffe, die durch Abstraktion aus den anschaulichen, vollständigen Vorstellungen der ersten Klasse gewonnen werden. Diese „Wurzel“ des Satzes vom Grund erläutert, warum Urteile wahr sind.
Die dritte Klasse betrifft „die reinen Anschauungen von Raum und Zeit, die Mathematik und die Geometrie.“ Diese Wurzel nennt Schopenhauer den Satz vom Grunde des Seins. Diese Gegenstände können nur a priori angeschaut werden und ihre notwendigen Beziehungen beziehen sich in der Arithmetik auf die Zeit und in der Geometrie auf den Raum.[16]
Für alle vier Klassen gilt gleichsam:
„Aber nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes, kann Objekt für uns werden: sondern alle unsre Vorstellungen stehn in einer gesetzmäßigen und der Form nach a priori bestimmbaren Verbindung. Diese Verbindung ist diejenige Art der Relation, welche der Satz vom zureichenden Grund allgemein genommen ausdrückt.“ (Deu-III:18)
Die für die Handlungstheorie und damit auch der Charakterlehre entscheidende Wurzel dieses Satzes vom zureichenden Grund ist die vierte, welche das Subjekt des Wollens bzw. den eigenen Willen behandelt.
Nach einer Handlung „halten wir uns berechtigt zu fragen Warum? d.h. wir setzen als nothwendig voraus es sey ihm etwas vorhergegangen daraus es erfolgt ist.“ (Deu-III:77) Wir erkennen nach Schopenhauer, dass etwa in einer bedrohlichen Situation, wie einem Brand des eigenen Hauses unsere Entschlüsse, unsere Handlungen, nicht notwendig aus der Situation erfolgen. Es ist weder logisch notwendig, verzweifelt nach Wasser zu suchen, um den Brand zu löschen, noch ist es logisch notwendig, aus dem Haus zu fliehen – auch folgt aus keiner Situation logisch, dass man sich um jüngere, vielleicht verwandte Mitmenschen im Haus kümmert. Während diese Optionen zwar naheliegend sind, können sie doch nicht logisch notwendig sein. Sonst wäre es möglich (aber nicht logisch zwingend), dass man das menschliche Verhalten in diesen Situationen vorhersagen kann. Schopenhauer meint 1813, dass hier das Gesetz der Kausalität offenbar nicht gilt.
Schopenhauer sucht nach einem Grund für das Handeln, die Antwort auf das „Warum?“ In uns selbst erkennen wir, so Schopenhauer, dass unser Handeln von unserem Wollen abhängt. Doch dieses ist nicht kausal gebunden, da sonst unserem Wollen ein vorheriger Zustand vorausginge, der uns bekannt sei (Deu-III:77).
Wenn nun eine Beziehung zwischen unserem Willen und unserem Handeln besteht, diese aber nicht kausal ist, so würde Schopenhauer in seinem Projekt scheitern, a priori die Gesetzmäßigkeit hinter diesem Warum anzugeben. Grundlose, spontane Handlungen lassen es nicht zu, a priori eine Gesetzmäßigkeit festzustellen.
Da Schopenhauer aber dennoch an der Berechtigung festhält, nach dem Grund eines Entschlusses zu einer Handlung zu fragen, muss er als Grund ein Motiv annehmen (Deu-III:77 f.). Ein Mensch kann in einer Situation verschiedene Motive (anschauliche oder abstrakte) haben, er kann die Pflicht als Motiv haben, aber eben auch die Rettung des eigenen Lebens. Die eigenen Motive liegen aber nicht bloß vor, sondern sie müssen erkannt werden und dieses Erkenntnis kann geschult werden. Im Falle des Hausbrands, in dem verschiedene Motive unmittelbar bekannt sein dürften, bedarf es dennoch eines Entschlusses zu einer Handlung. Wenn dieser Entschluss aber derart gefasst sein soll, dass die gewünschte und laut Schopenhauer von uns abgenommene a priori feststellbare Gesetzmäßigkeit (d.h., dass wir berechtigt sind, nach dem Grund, dem Warum, zu fragen) gewahrt bleibt, muss, wie er feststellt, angenommen werden, dass ein Mensch in ein und derselben Motivlage immer gleich handelt:
„Zur Annahme eines beharrlichen Zustandes des Subjekts des Willens, aus dem seine Entschlüsse mit Nothwendigkeit folgen, leitet uns die Bemerkung, daß unter gleichen aufweisbaren Motiven, abgesehn von den Modifikationen durch verschiedene Grade der Klugheit, der Eine so, der Andre anders handelt, derselbe aber, unter ganz gleichen Umständen, auf ganz gleiche Weise, also gleichsam nach Maximen, wenn auch diese nicht in abstrakten Sätzen seiner Vernunft bewußt sind, und er sogar das lebendigste Bewußtseyn hat, daß er auf ganz andre Weise handeln könnte, wenn er nur wollte, d.h. daß sein Wille durch nichts Fremdes bestimmt ist und hier also von keinem Können die Rede ist, sondern nur von einem Wollen, welches seiner Natur nach im höchsten Grade frey, ja das innerste von allem Andern unabhängige Wesen des Menschen selbst ist.“ (S. Deu-III:79 f.)
Dieses unabhängige Wesen des Menschen ist der (intelligible) Charakter. Schopenhauer schreibt daher später (und nicht im Widerspruch zu seiner Schrift von 1813): „Die Handlungen eines Menschen entspringen aus zwei Faktoren: 1° den äußeren Motiven, und 2° seinem Charakter.“[17]
Also: Der Mensch hat in einer Situation verschiedene Motive, die zu erkennen sind. Aus erkannten Motiven gehen Wünsche hervor und mittels eines Entschlusses geht aus einem, insofern es äußerlich möglich ist (wenn die entsprechende Handlungsfreiheit gegeben ist), eine Handlung hervor. Der Charakter bestimmt hierbei, wozu sich ein Mensch entschließt. Ein Mensch hat einen Charakter, der sich durch ein besonderes Pflichtbewusstsein auszeichnet, und ein anderer Mensch ist möglicherweise recht feige, hasenfüßig.
Der konstante (intelligible) Charakter gibt dieser Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund seine Gesetzmäßigkeit – mittels der genannten Annahmen. Der metaphysische Unterbau der Willensmetaphysik, die den konstanten Charakter von anderer Seite stützt, ist 1813 noch nicht entwickelt.
Schopenhauers Handlungstheorie nach 1813
Die zweite Auflage seiner Dissertation macht die vierte Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde obsolet, wenngleich Schopenhauer sie beibehält.[18] In dieser Auflage spielt der charakterlich geprägte „Entschluss“ eine deutlich geringere Rolle. Die vierte Wurzel wird ihrer Gestalt nach so verändert, dass sie unter der ersten zu subsumieren wäre.
Jede Handlung eines Menschen (aber auch eines Tieres) setzt nun nach Schopenhauer ein Motiv voraus. Dieses Motiv ist die Ursache der Handlung, wie auch der Stoß einer Kugel die Ursache ihrer Bewegung ist. Der Unterschied zwischen der Bewegung der Kugel und der eigenen Handlung ist nach Schopenhauer unsere Perspektive:
„Das Innere solcher Vorgänge hingegen bleibt uns dort ein Geheimniß: denn wir stehn daselbst immer draußen. Da sehn wir wohl diese Ursache jene Wirkung mit Nothwendigkeit hervorbringen: aber wie sie eigentlich Das könne, was nämlich dabei im Innern vorgehe, erfahren wir nicht. So sehn wir die mechanischen, physikalischen, chemischen Wirkungen, und auch die der Reize, auf ihre respektiven Ursachen jedes Mal erfolgen; ohne deswegen jemals den Vorgang durch und durch zu verstehn; sondern die Hauptsache dabei bleibt uns ein Mysterium: wir schreiben sie alsdann den Eigenschaften der Körper, den Naturkräften, auch der Lebenskraft, zu, welches jedoch lauter qualitates occultae sind. Nicht besser nun würde es mit unserm Verständniß der Bewegungen und Handlungen der Thiere und Menschen stehn, und wir würden auch diese auf unerklärliche Weise durch ihre Ursachen (Motive) hervorgerufen sehn; wenn uns nicht hier die Einsicht in das Innere des Vorgangs eröffnet wäre: wir wissen nämlich, aus der an uns selbst gemachten innern Erfahrung, daß dasselbe ein Willensakt ist, welcher durch das Motiv, das in einer bloßen Vorstellung besteht, hervorgerufen wird. Die Einwirkung des Motivs also wird von uns nicht bloß, wie die aller andern Ursachen, von außen und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar und daher ihrer ganzen Wirkungsart nach, erkannt. Hier stehn wir gleichsam hinter den Koulissen und erfahren das Geheimniß, wie, dem innersten Wesen nach, die Ursach die Wirkung herbeiführt: denn hier erkennen wir auf einem ganz andern Wege, daher in ganz andrer Art. Hieraus ergiebt sich der wichtige Satz: die Motivation ist die Kausalität von innen gesehn.“ (Deu-III:252 f.)
Die Motivation ist also die Kausalität von innen gesehen. So erklärt sich auch, dass Schopenhauer meint, dass ein fallender Stein, wenn er Bewusstsein hätte, fallen wollen würde, mit Recht (Deu-I:150).
Wie kann Schopenhauer nun die Motivation zur Kausalität erklären, wenn er an Kant das kausale Verhältnis zwischen intelligiblen und empirischen Charakter und damit die „Kausalität aus Freiheit“ kritisiert?
Im Hauptwerk führt Schopenhauer vor, wie man zum Ding an sich kommt. Zunächst stellt er fest, dass über die äußere sinnliche Wahrnehmung kein Zugang besteht und schließt damit an Kant an:
„Wir sehen schon hier, daß von außen dem Wesen der Dinge nimmermehr beizukommen ist: wie immer man auch forschen mag, so gewinnt man nichts, als Bilder und Namen. Man gleicht Einem, der um ein Schloß herumgeht, vergeblich einen Eingang suchend und einstweilen die Fassaden skitzirend. Und doch ist dies der Weg, den alle Philosophen vor mir gegangen sind.“ (Deu-I:118)
Darauf stellt Schopenhauer fest, dass es eine Erscheinung in der Welt gibt, deren Inneres wir kennen:
„Dieser Leib ist dem rein erkennenden Subjekt als solchem eine Vorstellung wie jede andere, ein Objekt unter Objekten: die Bewegungen, die Aktionen desselben sind ihm in soweit nicht anders, als wie die Veränderungen aller anderen anschaulichen Objekte bekannt, und wären ihm ebenso fremd und unverständlich, wenn die Bedeutung derselben ihm nicht etwan auf eine ganz andere Art enträthselt wäre. Sonst sähe er sein Handeln auf dargebotene Motive mit der Konstanz eines Naturgesetzes erfolgen, eben wie die Veränderungen anderer Objekte auf Ursachen, Reize, Motive. Er würde aber den Einfluß der Motive nicht näher verstehen, als die Verbindung jeder andern ihm erscheinenden Wirkung mit ihrer Ursache. Er würde dann das innere, ihm unverständliche Wesen jener Aeußerungen und Handlungen seines Leibes, eben auch eine Kraft, eine Qualität, oder einen Charakter, nach Belieben, nennen, aber weiter keine Einsicht darin haben. Diesem allen nun aber ist nicht so: vielmehr ist dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens das Wort des Räthsels gegeben: und dieses Wort heißt Wille.“ (Deu-I:118)
Schopenhauer zeigt, dass wir eine Innenperspektive haben und einen unmittelbaren Zugang zu etwas, das ansonsten wie andere empirische Gegenstände bloß mittelbar gegeben ist. Schopenhauer sieht den eigenen Willen als etwas unvermittelt Gegebenes, also auch als etwas, das sich nicht Anschauungsformen unterwerfen muss. Mittels eines bloßen Analogieschlusses macht er aus dem in sich gefundenen Willen den Willen zu Ding an sich (aller Erscheinungen):
„Wir werden demzufolge die nunmehr zur Deutlichkeit erhobene doppelte, auf zwei völlig heterogene Weisen gegebene Erkenntniß, welche wir vom Wesen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, weiterhin als einen Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein als Vorstellungen unserm Bewußtseyn gegeben sind, eben nach Analogie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits, ganz so wie er, Vorstellung und darin mit ihm gleichartig sind, auch andererseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellung des Subjekts bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende, seinem innern Wesen nach, das selbe seyn muß, als was wir an uns Wille nennen. Denn welche andere Art von Daseyn oder Realität sollten wir der übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine solche zusammensetzten? Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns gar nichts bekannt, noch denkbar.“ (Deu-I:125)
Wenn Schopenhauer in der zweiten Auflage der Dissertation die Handlungen und deren Motivationen zur Kausalität erklärt, dann ist damit bloß der empirische Charakter gemeint. Der Grund für eine Handlung ist das Motiv und der Charakter. Fragt man weiter nach dem „Warum?“ so findet sich innerhalb der ersten Klasse des Satzes vom zureichenden Grund die das Motiv und dessen „Warum?“. Der Charakter hingegen muss unveränderlich sein, da er ein Ding an sich ist und dieses nicht innerhalb der Zeit liegt. Darüber hinaus müsste Schopenhauer sonst ein weiteres „Warum?“ beantworten.
Jedenfalls erscheint es katastrophal, den Charakter bloß als empirischen Gegenstand zu betrachten – schon für Kant im 18. Jahrhundert, auch für Schopenhauer im 19. Jahrhundert und ebenso für uns im 21. Jahrhundert. Unser Rechtssystem geht nämlich von einem freien Willen aus.[19] Davon ging auch Kant aus und auch Schopenhauer braucht den freien Willen – ohne allerdings auf die Naturkausalität zu verzichten. Wie bereits oben dargestellt, betrachtet Schopenhauer Kants Leistung, Kausalität und Freiheit gleichermaßen bestehen zu lassen, zu seinen größten Leistungen.
Schopenhauer lässt den Willen als Ding an sich, mit der Freiheit, also der Unabhängigkeit von Kausalität, bestehen, zum einen wegen der oben ausgeführten Herangehensweise zum Ding an sich, zum anderen um die Verantwortlichkeit zu wahren, wie er 1839 schreibt:
„Da, wo die Schuld liegt, muß auch die Verantwortlichkeit liegen: und da diese das alleinige Datum ist, welches auf moralische Freiheit zu schließen berechtigt; so muß auch die Freiheit ebendaselbst liegen, also im Charakter des Menschen; um so mehr, als wir uns hinlänglich überzeugt haben, daß sie unmittelbar in den einzelnen Handlungen nicht anzutreffen ist, als welche, unter Voraussetzung des Charakters, streng necessitirt eintreten.“ (Deu-III:564)
Um Freiheit und Kausalität in Bezug, aber ohne kausale Beziehung zueinander zugleich bestehen lassen zu können, fordert Schopenhauer methodisch eine andere Form des „Erkennens“.
„Die zwei urverschiedenen Quellen unserer Erkenntniß, die äußere und die innere, müssen an diesem Punkte durch Reflexion in Verbindung gesetzt werden. Ganz allein aus dieser Verbindung entspringt das Verständniß der Natur und des eigenen Selbst: dann aber ist das Innere der Natur unserm Intellekt, dem für sich allein stets nur das Aeußere zugänglich ist, erschlossen, und das Geheimniß, dem die Philosophie so lange nachforscht, liegt offen. Dann nämlich wird deutlich, was eigentlich das Reale und was das Ideale (das Ding an sich und die Erscheinung) sei; […].“ (Deu-III:376 f.)
Die eigene Freiheit und die Naturkausalität bindet Schopenhauer aneinander, indem er den außerzeitlichen und damit unveränderlichen Willen als eine Perspektive darstellt, und die empirische, also räumliche, zeitliche und kausale Welt als eine andere Perspektive darstellt:
„Der Willensakt und die Leibesaktion sind nicht Ursach und Wirkung: denn zwischen ihnen ist keine Zeit: sondern sie sind Eines und Dasselbe: auf doppelte Weise wahrgenommen: einmal in der innern Erkenntniß (innerer Sinn) als Willensakt, und 2tens zu gleicher Zeit in der äußern Anschauung als Aktion des Leibes.“ (HNIV:233)
Der Charakter bei Schopenhauer
Intelligibler Charakter
Das Fremdwörterbuch verweist bei dem Begriff „intelligibel“ auf Kants Charakterlehre:
„intelligibler Charakter: der freie Wille des Menschen als Ding an sich; der Charakter als Kausalität aus Freiheit (Kant);“[20]
und verweist ferner auf die eigentliche Bedeutung dieses Wortes:
„nur durch den Intellekt u. nicht durch die sinnliche Wahrnehmung erkennbar;“[21]
Schopenhauer übernimmt von Kant das Konzept des intelligiblen Charakters, macht aber eine im Hinblick auf die Definition des Fremdwörterbuchs interessante und entscheidende Bemerkung: „vielleicht hieße es richtiger der inintelligible“ (Deu-III:80). Damit stellt Schopenhauer klar, was der intelligible Charakter, das Ding an sich in jedem Einzelnen, für ihn ist: etwas, das eben nicht erkennbar ist, auch nicht durch den Intellekt. Was der wahre Charakter eines Menschen ist, ist nicht erkennbar, weder für die Mitmenschen, noch für ihn selbst – auch nicht für ganz besondere Menschen, wie Genies oder Künstler.
Dies ist beinahe erstaunlich, da er das Ding an sich und den intelligiblen Charakter mit der Platonischen Idee gleichsetzt, die nach Schopenhauer eben von jenen besonderen Menschen direkt angeschaut werden kann („besseres Bewusstsein“ (HNI:153 ff.)):
„Das Daseyn überhaupt aber dieses Objekts und die Art seines Daseyns, d.h. die Idee, welche in ihm sich offenbart, oder mit anderen Worten, sein Charakter, ist unmittelbar Erscheinung des Willens.“ (Deu-I:338)
Der intelligible Charakter ist also gleichsam einer Platonischen Idee, als Ding an sich, nicht zu erkennen und er ist frei, wodurch es in diesem Sinne eine Willensfreiheit gibt: „Daß der Wille als solcher frei sei, folgt schon daraus, daß er, nach unserer Ansicht, das Ding an sich, der Gehalt aller Erscheinung ist. (Deu-I:337)
Ebenso wenig wie der intelligible Charakter erkennbar ist, kann er auch nicht geändert werden. Wie kommt Schopenhauer darauf, dass der Charakter nicht veränderlich ist? Aus bereits dargestellten Gründen, ist der intelligible (oder auch: wahre) Charakter ein Ding an sich – in Schopenhauers Interpretation. So wie Schopenhauer Kant versteht, oder verstehen wollte, bedeutet dies, dass notwendigerweise Raum und Zeit für das Ding an sich nicht gelten, wie er in der zweiten Auflage der Dissertation von 1847 zeigt:
„Denn indem er die transscendentalen Principien nachwies als solche, vermöge deren wir über die Objekte und ihre Möglichkeit Einiges a priori, d.h. vor aller Erfahrung, bestimmen können, bewies er daraus, daß diese Dinge nicht unabhängig von unserer Erkenntniß so daseyn können, wie sie sich uns darstellen. Die Verwandtschaft einer solchen Welt mit dem Traume tritt hervor.“ (Deu-III:129)
Dadurch gibt es, wie er wiederum überzeugend darlegt, keine Möglichkeit der Veränderung:
„Wäre andrerseits der Raum die alleinige Form der Vorstellungen dieser Klasse; so gäbe es keinen Wechsel: denn Wechsel, oder Veränderung, ist Succession der Zustände, und Succession ist nur in der Zeit möglich. Daher kann man die Zeit auch definiren als die Möglichkeit entgegengesetzter Bestimmungen am selben Dinge.“ (Deu-III:137)
Daher ist der wahre Charakter eines Menschen unveränderlich – wie eben auch Platonische Ideen.
Außerdem: Wenn der Charakter eine Veränderung durchliefe, müsste man die Frage stellen, was die Ursache dieser Veränderung sei. Kausalität schließt Schopenhauer bekanntlich für das Ding an sich aus, aber genau dieses ist der intelligible Charakter.
Die Unveränderlichkeit des Charakters und die Willensfreiheit bei gleichzeitiger Kausalität bringt Schopenhauer in diesem Satz zum Ausdruck:
„Unsre einzelnen Thaten sind nicht frei, hingegen der individuelle Charakter eines Jeden ist eine freie That: […] allein wie diese zum Bewußtsein kommen, hat Raum und Zeit zur Form: weshalb jene sich als ein Lebenslauf darstellen muß: an dem was wir thun, erkennen wir was wir sind.“[22]
Diese einmalige freie Tat des unvernünftigen Willens ist es, die als eine Seite der Medaille (Welt als Wille) nach Schopenhauer dafür sorgt, dass trotz der Kausalität (Welt als Vorstellung) als der anderen Seite der Medaille, Menschen keine von äußeren Fäden gezogenen, sondern einem inneren Uhrwerk getriebenen, Puppen sind (HNIII:531).
Empirischer Charakter
Während für den intelligiblen Charakter „die vollkommenste bis zur Allmacht gesteigerte Freiheit“[23] gilt, schreibt Schopenhauer für die Welt als Vorstellung:
„Man mache sich keine Illusion! Das Gesetz der Kausalität läßt keine Ausnahme zu: Alles, von der Bewegung des Sonnenstäubchens an, bis zum überlegten Thun des Menschen, ist ihm auf gleiche Weise unterworfen: nie seit die Welt steht, konnte ein Sonnenstäubchen fliegend eine andre Linie beschreiben, als die es beschrieb noch ein Mensch anders handeln, als er gehandelt hat.“[24]
Somit stimmt von dieser Perspektive auch der für Einstein tröstliche Satz von Schopenhauer, dass man tun kann, was man will, aber nicht wollen, was man will.[25]
Der empirische Charakter ist eine endliche Zahl von Handlungen eines Menschen in der objektiven Welt. Beobachtet man die Handlungen eines Menschen und stellt fest, dass dieser bereits des Öfteren andere Menschen betrogen hat, so könnte man, wie der scheinbar misstrauische Schopenhauer es offensichtlich selbst tat, auf einen sehr schlechten Charakter schließen:
„Man soll, wo möglich, gegen Niemanden Animosität hegen, jedoch die procédés eines Jeden sich wohl merken und im Gedächtniß behalten, um danach den Werth desselben, wenigstens hinsichtlich unserer, festzustellen und demgemäß unser Verhalten und Betragen gegen ihn zu regeln, - stets überzeugt von der Unveränderlichkeit des Charakters [H: einen schlechten Zug eines Menschen jemals vergessen, ist wie wenn man schwer erworbenes Geld wegwürfe]. So aber schützt man sich vor thörichter Vertraulichkeit und thörichter Freundschaft.“ (Deu-IV:515)
Nach Schopenhauers eigenem Konzept des empirischen Charakters ist der Zugang zum wahren, intelligiblen Charakter über die Beobachtungen der Handlungen eines Menschen allerdings nicht so einfach. Der Schluss von einzelnen, eben einer endlichen Zahl von Handlungen bis zu einem Tag, erfolgt schließlich induktiv (Deu-I:341 f.), und kann nichts mit Notwendigkeit über das Verhalten des Menschen am nächsten Tag voraussagen – noch weniger über seinen Charakter. Weder ist die spezielle Motivlage bekannt, noch der Charakter.
Der empirische Charakter ist bei Schopenhauer nichts weiter als die zeitliche Darstellung des intelligiblen Charakters:
„Dieser selbst also muß schon Erscheinung des Willens seyn, und muß zu meinem Willen im Ganzen, d.h. zu meinem intelligibeln Charakter, dessen Erscheinung in der Zeit mein empirischer Charakter ist, sich so verhalten, wie die einzelne Aktion des Leibes zum einzelnen Akte des Willens.“ (Deu-I:128)
Die Vielheit der Handlungen ergeben den erkennbaren empirischen Charakter, der eine bloße Erscheinung des intelligiblen Charakters ist (Deu-III:721). Wenn der empirische Charakter gegeben ist, dazu die komplette Motivlage und das jeweilige Erkenntnisvermögen, dann erfolgt daraus die Handlung mit absoluter Notwendigkeit.
Erworbener Charakter
Mit der Bedeutung des Charakters, etwa für die Zügelung der niederen, kurzfristigen Bedürfnisse, um höhere Ziele zu erreichen, im Hinterkopf erscheint weder der unveränderliche, freie intelligible Charakter, noch der an die Kausalität gebundene empirische Charakter besonders positiv. Wie soll in diesem System der Charakter reifen oder etwa Altersmilde eintreten?
Doch hier scheint Schopenhauer unerwartet Hoffnung zu machen und führt einen Begriff ein, der in Kants Charakterlehre unbekannt ist: den erworbenen Charakter.
„Haben wir es aber endlich gelernt, dann haben wir erlangt, was man in der Welt Charakter nennt, den erworbenen Charakter. Dieses ist demnach nichts Anderes, als möglichst vollkommene Kenntniß der eigenen Individualität: […] Dies setzt uns in den Stand, die an sich einmal unveränderliche Rolle der eigenen Person, die wir vorhin regellos naturalisirten, jetzt besonnen und methodisch durchzuführen und die Lücken, welche Launen oder Schwächen darin verursachen, nach Anleitung fester Begriffe auszufüllen.“ (Deu-I:359 f.)
Auch wenn dieses Zitat nochmals von einer „unveränderlichen Rolle“ des Einzelnen spricht, scheint doch irgendeine Form von Besserung möglich zu sein. Bestärkt wird diese Annahme der Besserungsmöglichkeit durch eine Vielzahl an Beispielen im 68. Paragraphen des Hauptwerkes, Die Welt als Wille und Vorstellung. Schopenhauer zählt hier viele Beispiele aus der Geschichte, seiner Gegenwart und der Fiktion auf, in denen sich Menschen gebessert haben. So befindet er etwa, dass Hoffnungslosigkeit und Tod bei Goethes Gretchen zur Besserung beigetragen hat (Deu-I:464). Aber auch ohne Hoffnungslosigkeit oder Tod kann mittels des Erkenntnisvermögens eine Besserung eintreten und eine Bekehrungsgeschichte voller Reue und Buße hervorbringen (Deu-I:466).
Ist dieser Paragraph ein Ausreißer in seiner Charakterlehre? Oder lässt sich die Besserung wieder einreihen, sodass auch die Bedeutung des erworbenen Charakters dahinschwindet? Notwendig sind in Schopenhauers Charakterlehre für eine Handlung, wie er in den Pandectae schreibt, zwei Dinge: Motivation und Charakter.[26] Dazu gehören aber auch, wie bereits dargelegt, die äußere Möglichkeit und noch viel wichtiger, die Erkenntnis der Motive. Erkennt man die eigenen Motive nicht richtig, handelt man nicht seinem Willen gemäß – dann kommt es nach späterer Erkenntnis zur Reue.[27]
Die für Schopenhauer bedeutsamste Erkenntnis ist jene, die er Kant, Platon, den Upanishaden und seiner unmittelbaren Anschauung verdankt, nämlich, dass unsere objektive Welt, die Sinneswelt, – in Schopenhauers Worten – „eine Lüge“ ist, und dass alle Erscheinungen „Eins“ sind. Schopenhauers Analogieschluss, mit welchem er von seinem inneren Willen auf einen Willen in allen Erscheinungen schloss, muss dafür um seine Ansicht erweitert werden, dass Raum und Zeit notwendig nur in der Welt der Erscheinungen, in der Welt als Vorstellung, existieren. Daraus ergibt sich, dass auch Vielheit nur in den Erscheinungen existiere (principio individuationis), nicht aber in der Perspektive jenseits der Erscheinungen. Daher gibt es nur den Einen Willen.[28] Diese Erkenntnis drückt Schopenhauer in seinem handschriftlichen Nachlass in den Pandectae grafisch aus (Abbildung 1). In der Welt als Vorstellung (oben) finden sich Vielheit, Diversität, Egoismus, Zeit, Raum und Erscheinung, während die (Platonische) Idee aller Ideen das Ding an sich und die Einheit ist. Diese Erkenntnis führt zum Gegenteil des Egoismus, zur Verneinung des Willens, also zu einem asketischen Zustand, in dem man indifferent zum eigenen Leben wird:
„Ist nun aber dieses Durchschauen des principii individuationis, diese unmittelbare Erkenntniß der Identität des Willens in allen seinen Erscheinungen, in hohem Grade der Deutlichkeit vorhanden; so wird sie sofort einen noch weiter gehenden Einfluß auf den Willen zeigen. Wenn nämlich vor den Augen eines Menschen jener Schleier der Maja, das principium individuationis, so sehr gelüftet ist, daß derselbe nicht mehr den egoistischen Unterschied zwischen seiner Person und der fremden macht, sondern an den Leiden der anderen Individuen so viel Antheil nimmt, wie an seinen eigenen, und dadurch nicht nur im höchsten Grade hülfreich ist, sondern sogar bereit, sein eigenes Individuum zu opfern, sobald mehrere fremde dadurch zu retten sind; dann folgt von selbst, daß ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden alles Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmerz der ganzen Welt sich zueignen muß. Ihm ist kein Leiden mehr fremd. Alle Quaalen Anderer, die er sieht und so selten zu lindern vermag, alle Quaalen, von denen er mittelbar Kunde hat, ja die er nur als möglich erkennt, wirken auf seinen Geist, wie seine eigenen.“ (Deu-I:447)
Diese Erkenntnis führt zum Motiv des Mitleids, mit welchem aus einem äußerlich schlechten Menschen ein guter Mensch werden kann.

Aus: Na 50 Nachlass Arthur Schopenhauer - 'Schopenhauer-Archiv', 1413 - Pandectae, S.249
Die Erkenntnis liegt bei Schopenhauer, anders als der wahre Charakter, in der Welt als Vorstellung, damit in der Zeit: Sie ist veränderbar. Man kann Erkenntnis gewinnen, und mit dieser Erkenntnis um Schopenhauers wahre Beschaffenheit der Welt, die beschriebene Besserung erlangen. Erkenntnisse kann man allerdings auch verlieren, sodass Menschen in der Erscheinung an einem Tag als die reuigsten Sünder auftreten können und am nächsten Tag schon wieder „rückfällig“ sind:
„Eine Erkenntniß der oben erwähnten Art, von der Beschaffenheit dieses Daseyns, kann jedoch auch wieder mit ihrem Anlaß zugleich sich entfernen, und der Wille zum Leben, und mit ihm der vorige Charakter, wieder eintreten. So sehen wir den leidenschaftlichen Benvenuto Cellini, ein Mal im Gefängniß und ein anderes Mal bei einer schweren Krankheit, auf solche Weise umgewandelt werden, aber nach verschwundenem Leiden wieder in den alten Zustand zurückfallen.“ (Deu-I:467)[29]
Wenn davon ausgegangen wird, dass diese Beispiele der Besserung über die Erkenntnis der Motive nur den wenigen Menschen von „großem Geist“ oder speziellen Lebenserfahrungen abhängen, bleibt offen, wie der Rest der Menschheit sich bessern kann. Schopenhauer verspricht Menschen Besonnenheit, sobald sie sich selbst besser kennengelernt haben, und demnach ihren Charakter erworben haben. Doch was genau haben Menschen dann erworben? „Wissen von den unabänderlichen Eigenschaften seines eigenen empirischen Charakters“ (Deu-I:359). Der Charakter eines Menschen wird in der schopenhauerschen Charakterlehre auch durch die Lebenserfahrung nicht verändert: „hingegen ein Tropf bleibt ein Tropf“ (Deu-IV:352).
Der erworbene Charakter ist nichts mehr als die eigene Kenntnis vom eigenen empirischen Charakter: Man kann sich immer wieder in verschiedenen und gleichen Situationen und Motivlagen beobachten und etwa konsterniert zur Kenntnis nehmen, dass man wieder einmal eine unglückliche Entscheidung getroffen hat. Besserung gibt es dadurch nicht direkt.
Indirekt aber hilft die Erkenntnis um den eigenen Charakter in Schopenhauers Lehre, da man die Fähigkeit erwirbt, das eigene Verhalten vorauszusehen. Man weiß, wenn man sich selbst gut genug kennt, eben schon vorher, dass es beispielsweise unklug wäre, sich der Versuchung auszusetzen, große Mengen Süßwaren im eigenen Haushalt aufzubewahren. Die Kenntnis um den eigenen Charakter liefert die Möglichkeit, vorbeugend zu handeln und so den schlechten Charakterzügen es nicht zu erlauben hervorzutreten, nicht aber den eigenen Charakter zu verändern (Deu-I:360).
Für den erworbenen Charakter gilt dabei, was auch für die Kenntnis eines empirischen Charakters gilt, da er nicht mehr als mein eigener empirischer Charakter ist: Das Wissen ist nie komplett, da stets induktiv aus beobachteten bisherigen Handlungen geschlossen wurde. Es besteht immer die Möglichkeit eines schwarzen Schwans – und dieser steht eben nicht für die Veränderung des Charakters, sondern die veränderte Erkenntnis.
Die Erkenntnis ist, wie in der Handlungstheorie bereits dargelegt, ein notwendiges Bindeglied zwischen Motiv und Handlung. Wenn die eigenen Motive nicht erkannt werden, werden sie nicht kausal für Handlungen. Wenn Menschen im Alter besser werden, so liegt dies bei Schopenhauer darum auch am gereiften Erkenntnisvermögen – ebenso können Menschen im Alter schlechter werden:
„Es kann zwar kommen, daß ein Mensch im Alter etwas besser, ein anderer wiederum schlechter erscheint, als er in der Jugend war: Dies liegt aber bloß daran, daß im Alter, in Folge der reifern und vielfach berichtigten Erkenntniß, der Charakter reiner und deutlicher hervortritt; während in der Jugend Unwissenheit, Irrthümer und Chimären bald falsche Motive vorschoben, bald wirkliche verdeckten […]“ (Deu-III:722)
Was hoffnungsvoll am erworbenen Charakter schien, ist es am Ende nicht. Wer seinen Charakter erwirbt, erfährt im Grunde genommen nur, wer er ist, ohne jegliche Möglichkeit sich zu ändern:
„Unsere Thaten sind allerdings kein erster Anfang, daher in ihnen nichts wirklich Neues zum Daseyn gelangt: sondern durch das was wir thun, erfahren wir bloß was wir sind.“ (Deu-III:530)
Der Charakter eines Tieres Charakter – die Idee der Gattung
Da der Fokus dieser Arbeit nicht auf dem tierischen, sondern dem menschlichen Charakter liegt, aber der Einfluss Platons auf Schopenhauers Charakterlehre mit jener aber besser darstellbar ist, folgt noch eine kurze Darstellung des tierischen Charakters.
Die Objektivation des Willens, der einen Platonischen Idee bzw. des Dings an sich, ist bei Schopenhauer das „Sichdarstellen in der realen Körperwelt“ (Deu-II:277), als Erscheinung. Ob Stein,[30] Pflanze, Tier oder Mensch: Es sind alles Objektivationen. Nur der Grad ist verschieden. So kann Schopenhauer auch all diesen vier Arten jeweils einen empirischen und intelligiblen Charakter zuordnen. Je höher der Grad der Objektivation ist, desto mehr unterscheiden sich die einzelnen Ideen von einander: Menschen haben allesamt verschiedene Charaktere und niedere Tiere haben Gattungscharaktere, sodass ein Igel dem anderen in seinem Handeln bei gleicher Motivlage[31] gleicht:
„Der empirische Karakter der Thiere ist viel besser zu ergründen, da jede Species nur Einen hat, der sich in jedem Individuo eben so deutlich und mit eben so geringen Abweichungen darstellt, als der Typus der äußern Beschaffenheit der Species. Daher läßt sich der empirische Karakter der Species sehr gut aus Erfahrungen, die an verschiedenen Individuen gemacht sind, zusammensetzen, und wie in jedem bestimmten Fall ein Hund, eine Katze, ein Affe handeln werde, weiß Jemand, der mehrere Individuen der Species aufmerksam beobachtet hat, sehr wohl vorherzusagen. Bei unvollkommneren Thiergattungen noch besser und mit einem hohen Grad von Gewißheit. Die Bewegungen der Infusionsthierchen sollen sogar nur in bestimmten mathematischen Figuren geschehn.“ (Deu-III:81 f.)
Wenn Menschen, Tiere oder Pflanzen sich vermehren, dann erfüllen sie den Zweck der Gattung: Sie erhalten durch den empirischen Akt die Idee ihrer Gattung (Abbildung 1 mag davon ein Bild geben).
Wenn es über Schopenhauer heißt, dass er in jedem seiner Hunde, die alle Atma[32] hießen, den gleichen Charakter vorliegen sah, so stimmt das nur bedingt mit seiner Charakterlehre überein: Einen Hund hielt er für so hoch entwickelt, dass es Unterschiede in diesem Gattungscharakter gibt, wie es auch zwischen der allgemeinen Kenntnis über Menschen und der Kenntnis eines einzelnen, bzw. seines empirischen Charakters, Unterschiede gibt.
Rezeption der Schopenhauerschen Charakterlehre
Allgemeines
Nachdem sowohl der Ursprung der Charakterlehre Schopenhauers, wie auch sie selbst dargestellt wurden, soll im Folgenden noch eine kurze Übersicht auf die Rezeption gegeben werden.
Einer positiven Rezeption der schopenhauerschen Charakterlehre waren mindestens drei Umstände hinderlich: Erstens war Schopenhauer in der akademischen Philosophie nicht sonderlich erfolgreich,[33] Vorlesungen zu seiner Philosophie hielt er lediglich im Sommersemester 1820. Somit ist die Begründung einer „Schule“ schon unwahrscheinlich.
Zweitens ist die Charakterlehre engt verknüpft mit seiner voraussetzungsreichen Willensmetaphysik. Der eine Gedanke Schopenhauers („Meine ganze Ph[ilosophie] läßt sich zusammenfassen in dem einen Ausdruck: die Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.“, HNI:462) bindet die Charakterlehre, wie sie auch selbst bindet. Wer Schopenhauers Charakterlehre übernimmt, braucht dazu die Willensmetaphysik. Wer sich aber dieser entledigen will, hat im Kern statt der schopenhauerschen die kantische Charakterlehre.
Drittens mag die Methodik Schopenhauers einer weiteren Verbreitung im Weg gestanden haben. Wie bereits ausgeführt, sind viele Schlüsse induktiv, oder Analogieschlüsse von der Wirkung auf die Ursache. Dass eine klare Methodik, insbesondere eine formallogische, war für Schopenhauer nicht bedeutsam:
„Wollte ein Philosoph damit anfangen, die Methode, nach der er philosophiren will, sich auszudenken; so gliche er einem Dichter, der zuerst sich eine Aesthetik schriebe, um sodann nach dieser zu dichten: Beide aber glichen einem Menschen, der zuerst sich ein Lied sänge und hinterher danach tanzte. Der denkende Geist muß seinen Weg aus ursprünglichem Triebe finden: Regel und Anwendung, Methode und Leistung müssen, wie Materie und Form, unzertrennlich auftreten. Aber nachdem man angelangt ist, mag man den zurückgelegten Weg betrachten. Aesthetik und Methodologie sind, ihrer Natur nach, jünger als Poesie und Philosophie; wie die Grammatik jünger ist als die Sprache, der Generalbaß jünger als die Musik, die Logik jünger als das Denken.“ (Deu-II:133)
Schopenhauer seine Methodik als Stärke dar und beruft sich damit wieder auch seine unmittelbare Anschauung. Diese und seine Ablehnung strengerer Logik sieht er als Stärken:
„In andern philosophischen Systemen ist die Konsequenz dadurch zu Wege gebracht, daß Satz aus Satz gefolgert wird. Hiezu aber muß nothwendigerweise der eigentliche Gehalt des Systems schon in den allerobersten Sätzen vorhanden seyn; wodurch denn das Uebrige, als daraus abgeleitet, schwerlich anders, als monoton, arm, leer und langweilig ausfallen kann, weil es eben nur entwickelt und wiederholt, was in den Grundsätzen schon ausgesagt war. […] Meine Sätze hingegen beruhen meistens nicht auf Schlußketten, sondern unmittelbar auf der anschaulichen Welt selbst, und die, in meinem Systeme, so sehr wie in irgend einem, vorhandene strenge Konsequenz ist in der Regel nicht eine auf bloß logischem Wege gewonnene; vielmehr ist es diejenige natürliche Uebereinstimmung der Sätze, welche unausbleiblich dadurch eintritt, daß ihnen sämmtlich dieselbe intuitive Erkenntniß, nämlich die anschauliche Auffassung des selben, nur successive von verschiedenen Seiten betrachteten Objekts, also der realen Welt, in allen ihren Phänomenen, unter Berücksichtigung des Bewußtseyns, darin sie sich darstellt, zum Grunde liegt. […] Dies ist Dem analog, daß wir bisweilen, wenn wir ein Gebäude zum ersten Mal und nur von Einer Seite erblicken, den Zusammenhang seiner Theile noch nicht verstehn, jedoch gewiß sind, daß er nicht fehlt und sich zeigen wird, sobald wir ganz herumgekommen. […] Dem entsprechend hat meine Philosophie einen breiten Boden, auf welchem Alles unmittelbar und daher sicher steht; während die andern Systeme hoch aufgeführten Thürmen gleichen: bricht hier eine Stütze, so stürzt Alles ein.“ (Deu-IV:149 f.)
Mit der Logik als zentraler Methode der Philosophie erklärt sich leicht, dass Schopenhauer wenig positiv aufgenommen wurde.
Nietzsche
Zu den bekanntesten, wenigstens kurzzeitigen, Verehrern Schopenhauers gehört Friedrich Nietzsche. Was hat Nietzsche von seinem ehemaligen „Erzieher“ übernommen?
Nietzsche hat kein System hervorgebracht und auch nicht hervorbringen wollen,[34] wie er schreibt:
„Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.“ (KSA06:63)
Das System von Arthur Schopenhauer, in dem die Einzelteile voneinander so abhängig sind, konnte Nietzsche in seiner Gesamtheit praktisch nur ablehnen. Dennoch finden sich natürlich Ähnlichkeiten zwischen Nietzsches und Schopenhauers Schriften.
Nietzsche hat beispielsweise das Verhältnis zwischen dem intelligiblen und dem erworbenen Charakter hervorgehoben und sowohl den Ausspruch, dass man werden soll, wer man ist, geprägt.[35]
Relevant für eine „Charakterlehre“ bei Nietzsche ist Ecce Homo in Warum ich so klug bin:
„An dieser Stelle ist nicht mehr zu umgehn die eigentliche Antwort auf die Frage, wie man wird, was man ist, zu geben. Und damit berühre ich das Meisterstück in der Kunst der Selbsterhaltung - der Selbstsucht ... Angenommen nämlich, dass die Aufgabe, die Bestimmung, das Schicksal der Aufgabe über ein durchschnittliches Maass bedeutend hinausliegt, so würde keine Gefahr grösser als sich selbst mit dieser Aufgabe zu Gesicht zu bekommen. Dass man wird, was man ist, setzt voraus, dass man nicht im Entferntesten ahnt, was man ist. Aus diesem Gesichtspunkte haben selbst die Fehlgriffe des Lebens ihren eignen Sinn und Werth, die zeitweiligen Nebenwege und Abwege, die Verzögerungen, die »Bescheidenheiten«, der Ernst, auf Aufgaben verschwendet, die jenseits der Aufgabe liegen. Darin kann eine grosse Klugheit, sogar die oberste Klugheit zum Ausdruck <kommen>: wo nosce te ipsum das Recept zum Untergang wäre, wird Sich-Vergessen, Sich-Missverstehn, Sich-Verkleinern, -Verengern, -Vermittelmässigen zur Vernunft selber.“ (KSA06:293)
Metaphysik spielt an dieser Stelle keine Rolle, aber die Unterscheidung von zwei Arten von Charakter: Zum einen gibt es etwas Angeborenes und zum anderen etwas Erlerntes. Da der erworbene Charakter bei Schopenhauer nichts anderes als die eigene Kenntnis des eigenen empirischen Charakters ist, vermisst man bei dem „Werden, wer man ist“ nicht eine dritte Charakterart bei Nietzsche. Wie bei Schopenhauer auch, kann man sich bei Nietzsche über den eigenen Charakter irren, und man kann sich erkennen lernen, aber auch die Erkenntnisse vergessen. Wenn man sich besser kennt, kann man sich Übel ersparen.
Mainländer
Philipp Mainländer hat von Schopenhauer einen Großteil der Willensmetaphysik übernommen und damit auch von der Charakterlehre. Wie das folgende Zitat zeigt, macht Mainländer allerdings einen besonderen Unterschied, in dem er nicht von einer metaphysischen Einheit ausgeht, sondern einer Vielheit. Somit ist jedes Individuum der Erscheinung eine Platonische Idee:
„Insofern aber vom besonderen Wesen eines individuellen Willens zum Leben die Rede ist, von seinem eigenthümlichen Charakter, der Summe seiner Eigenschaften, nenne ich ihn Idee schlechthin, und haben wir mithin genau ebenso viele Ideen, als es Individuen in der Welt giebt. Die immanente Philosophie legt den Schwerpunkt der Idee dahin, wo ihn die Natur hinlegt: nämlich in das reale Individuum, nicht in die Gattung, welche nichts Anderes, als ein Begriff, wie Stuhl und Fenster, ist, oder in eine unfaßbare erträumte transscendente Einheit in, über oder hinter der Welt und coexistirend mit dieser.“[36]
Bei Mainländer finden sich die Unterscheidungen zwischen intelligibel, empirisch und erworben nicht explizit. Aber er unterscheidet durchaus zwischen der empirischen Realität und den Dingen an sich, die bei ihm eben einzelne Ideen sind.
Die empirische Realität ist bei ihm von strenger Notwendigkeit geprägt, sowohl auf den fallenden Stein bezogen als auch auf Menschen und Tiere, die sich bei einem zureichenden Motiv „widerstandslos“ ergeben.[37]
Freiheit und der freie Wille, wie sie bei Kant und Schopenhauer einen besonderen (wenngleich sehr verschiedenen) Platz hatten, findet sich bei Mainländer nicht: In der empirischen Welt ist kein Platz für sie, sagt er noch in Übereinstimmung mit Kant und Schopenhauer,[38] doch auch darüber hinaus ist es für ihn wenigstens sinnlos, von ihr zu sprechen:
„Was Freiheit in philosophischer Bedeutung (liberum arbitrium indifferentiae) sei, können wir zwar mit Worten bestimmen und etwa sagen, daß sie die Fähigkeit eines Menschen von einem bestimmten Charakter sei, einem zureichenden Motiv gegenüber zu wollen oder nicht zu wollen; aber denken wir auch nur einen Augenblick über diese so leicht bewerkstelligte Verbindung von Worten nach, so erkennen wir sofort, daß wir niemals einen realen Beleg für diese Freiheit erlangen werden, wäre es uns auch möglich, Jahrtausende lang die Handlungen sämmtlicher Menschen bis auf den Grund zu prüfen.“[39]
Fazit
Die Charakterlehre Schopenhauers steht also, wie seine gesamte Philosophie in der Hauptsache, auf den Schultern von Kant und Platon. Kants Philosophie und die Unterscheidungen Erscheinung – Ding an sich und empirisch – intelligibel übernimmt Schopenhauer, vereint diese aber auf seine Weise mittels der kritikwürdigen „besseren Erkenntnis“ mit Platon und der indischen Philosophie. An die Stelle des Dings an sich setzt er die Platonische Idee und den Willen, den jeder Mensch (und auch jedes Tier) in sich spürt.
Den Gegensatz von Naturkausalität und Freiheit, den Kant in seiner dritten Antinomie aufzulösen versucht, kritisiert Schopenhauer. Hier ist fraglich, wie Kant zu interpretieren ist: In welcher Art ist die intelligible Ursache direkt verursachend für die empirische Erscheinung? Die überzeugendere Lesart, wonach dies zwei Seiten derselben Medaille wären, ist letztlich diejenige, die sich schließlich auch bei Schopenhauers Charakterlehre findet. Betrachtet man also bloß den empirischen und den intelligiblen Charakter, so fallen die Unterschiede zwischen Schopenhauer und Kant bestenfalls klein aus. Mit der Gleichsetzung des Dings an sich mit der Idee trennt sich Schopenhauer von Kant deutlich. Mit diesem Schritt bindet Schopenhauer Kants zwei Charakterarten in eine Willensmetaphysik, die ihn letztendlich von allen bekannten Philosophen trennt.
Der erworbene Charakter, den Schopenhauer als dritte Charakterart ergänzend zu Kant einführt, ist die Selbsterkenntnis, mit deren Hilfe man das eigene Leben zunehmend besser gestalten kann. Dieser Charakter stellt sich allerdings nicht als eine Möglichkeit der eigenen Besserung dar, sondern verspricht anstelle einer moralischen Besserung durch Anerkennung des eigenen moralischen Charakters bloß die Möglichkeit, moralisch potenziell schwierigen Situationen aus dem Weg zu gehen.
Die eingangs formulierte Frage nach der Möglichkeit der Besserung, um disziplinierter oder moralischer zu handeln, verneint in diesem Sinne nicht nur Schopenhauer, sondern sie scheint auch von Nietzsche und Mainländer verworfen oder negativ beantwortet zu werden. In diesem Sinn „bleibt ein Tropf ein Tropf“.
Unbeachtet hat diese Arbeit die Vererbungslehre Schopenhauers gelassen, weil diese zum einen nicht mehr als ein späterer Zusatz zu seinem Werk ist (1859), also weder in der Entwicklung seiner eigenen Charakterlehre vor 1818, noch in seinem System wesentlich ist. Die Vererbungslehre ist offensichtlich bloß eine Sammlung von Beobachtungen, die Schopenhauer dann mit seinem System zu erklären versucht bzw. in sein System einbindet:
„Zuvörderst betrachte er sich selbst, gestehe sich seine Neigungen und Leidenschaften, seine Charakterfehler und Schwächen, seine Laster, wie auch seine Vorzüge und Tugenden, wenn er deren hat, ein: dann aber denke er zurück an seinen Vater, und es wird nicht fehlen, daß er jene sämmtlichen Charakterzüge auch an ihm gewahr werde. Hingegen wird er die Mutter oft von einem ganz verschiedenen Charakter finden, und eine moralische Uebereinstimmung mit dieser wird höchst selten, nämlich nur durch den besondern Zufall der Gleichheit des Charakters beider Eltern, Statt finden.“ (Deu-II:591)
Möglicherweise wäre diese späte Entwicklung Schopenhauers allerdings auch ein interessanter Anknüpfungspunkt zu einer Untersuchung, wie sich die Charakterlehre Schopenhauers zu den Ansätzen einer Evolutionslehre verhält.[40]
- [1] Amitai Etzioni, Spirit Of Community, New York 1993, S. 91.
- [2] Friedrich Schiller, Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen, in: Schillers Sämmtliche Werke, vierter Band, Stuttgart 1879, aufgerufen am 03.01.2019 über Projekt Gutenberg <http://gutenberg.spiegel.de/buch/ueber-die-asthetische-erziehung-des-menschen-in-einer-reihe-von-briefen-3355/2>.
- [3] Vgl. Nico Naeve/Hernán Pringe, Antinomie der reinen Vernunft, in: Marcus Willaschek/Jürgen Stolzenberg/Georg Mohr/Stefano Bacin (Hrsg.), Kant-Lexikon, Band 1: a priori/a posteriori – Gymnastik, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH 2015, S. 132.
- [4] Vgl. Claudia Graband, Charakter, empirischer/intelligibler, in: Willaschek/Stolzenberg/Mohr/Bacin (Hrsg.), Kant-Lexikon, Band 1, Berlin/Boston 2015, S. 318 f.
- [5] Vgl. Kants Beispiel vom Dieb, der trotz Determinismus straffähig ist: KpV A 171 ff.
- [6] Vgl. Claudia Graband, Charakter, empirischer/intelligibler, in: Willaschek/Stolzenberg/Mohr/Bacin (Hrsg.), Kant-Lexikon, Band 1, Berlin/Boston 2015, S. 318.
- [7] Diese Kritik an Kant findet sich in ähnlicher Form schon in seinen Studienheften von 1813 bis 1818: HNII:421.
- [8] In der ersten Auflage der Schopenhauerschen Dissertation von 1813 ist das Wollen und die Motivation noch außerhalb der Kausalität.
- [9] Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Frankfurt: Suhrkamp 2017, S. 2486.
- [10] Vgl. Matthias Koßler, Die Welt als inintelligibler und empirischer Charakter, in: 97. Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft 2016, S. 96.
- [11] Weswegen Schopenhauer auch schreibt:„Kant’s schwache Seite ist das worin Göthe groß ist; - und umgekehrt.“ Pandectae 353,2 zitiert nach: Arthur Schopenhauer, Pandectae. Philosophische Notizen aus dem Nachlass. Herausge-geben von Ernst Ziegler, München: C.H.Beck 2016, S. 397.
- [12] Zu dieser indischen Philosophie/Religion hatte er Zugang über eine lateinische Übersetzung eines aus dem Sanskrit ins Persische übersetzten Textes.
- [13] Dass es Schopenhauer mit der Vereinigung von Platon und Kant ernst ist, zeigt nicht nur diese Stelle des „jungen“ Schopenhauers in der Zeit vor dem Hauptwerk, sondern auch noch deutlicher das Hauptwerk selbst: „Hätte man jemals Kants Lehre, hätte man seit Kant den Platon eigentlich verstanden und gefaßt, hätte man treu und ernst dem innern Sinn und Gehalt der Lehren beider großer Meister nachgedacht, statt mit den Kunstausdrücken des einen um sich zu werfen und den Stil des andern zu parodiren; es hätte nicht fehlen können, daß man längst gefunden hätte, wie sehr die beiden großen Weisen übereinstimmen und die reine Bedeutung, der Zielpunkt beider Lehren, durchaus derselbe ist.“ (Deu-I:204)
- [14] Vgl. Katia Saporiti, Ideen, in: Stefan Jordan/Christian Nimtz (Hrsg.), Lexikon Philosophie. 100 Grundbegriffe. Stuttgart 2011, S. 132 ff.
- [15] Vgl. Arthur Schopenhauer, Pandectae. Philosophische Notizen aus dem Nachlass. Herausgegeben von Ernst Ziegler, München: C.H.Beck 2016, S. 392 ff.
- [16] Vgl. Matteo Vincenzo, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde, übersetzt aus dem Italienischen von Ilaria Massari, in: Daniel Schubbe/Matthias Koßler (Hrsg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2018, S. 25 ff.
- [17] Arthur Schopenhauer, Pandectae, München 2016, S. 263 f.
- [18] Möglicherweise aus ästhetischen Gründen. Die Zahl 4 gilt als „seine“ Zahl, wie die Zahl 3, die dann der Anzahl seiner Wurzeln des Satzes vom zureichenden Grunde entspräche, als die Zahl von Hegel gilt. Die Zahl 4 findet sich bei Schopenhauer etwa in der Anzahl der Bücher des Hauptwerkes von 1818, in den genannten vier Wurzeln, in dem vom ihm (in seiner Jugend) entwickelten Ideal der Tetragamie, in §17 der ersten Auflage der Dissertation „Ihre Vierheit“, der allerdings in der zweiten Auflage verschwindet, in den vier Arten von Ursachen und vier Arten von raumzeitlichen Dingen („leblose Körper, Pflanzen, Thiere und Menschen“) (Deu-IX:7 f.).
- [19] Vgl. Heinrich Foth, Tatschuld und Charakter, in: 60. Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft 1979, S. 150.
- [20] Duden (Hrsg.), Das Fremdwörterbuch, Berlin: Duden-Verlag 2015, S. 494.
- [21] Ebd.
- [22] Arthur Schopenhauer, Pandectae. Philosophische Notizen aus dem Nachlass. Herausgegeben von Ernst Ziegler, München: C.H.Beck 2016, S. 261.
- [23] Ebd., S. 263.
- [24] Ebd. S. 262.
- [25] Vgl. Carl Seelig (Hrsg.), Albert Einstein. Mein Weltbild. Zürich 2010, S. 9.
- [26] Vgl. Arthur Schopenhauer, Pandectae, München 2016, S. 263 f.
- [27] Vgl. Arthur Schopenhauer, Vorlesung über die gesamte Philosophie. 4. Teil: Metaphysik der Sit-ten, herausgegeben von Daniel Schubbe, Hamburg: Felix Meiner Verlag 2017, S. 43 ff.
- [28] Hier macht es sich Schopenhauer vielleicht etwas einfach, da auch „Einheit“ ein Begriff der Erscheinungen ist, wie auch „Unendlichkeit“ ein zeitlicher Begriff ist.
- [29] An dieser Stelle nutzt Schopenhauer den Begriff des Charakters missverständlich. Dieser ganze Paragraph scheint allerdings tendenziell im Widerspruch zu seiner Charakterlehre zu stehen: Durch die empirische Erkenntnis soll der metaphysische Wille, der doch frei ist, wenden und enden. Dies ist widersprüchlich. Im Rahmen einer wohlwollenden Auslegung ordnet diese Arbeit den §68 über die Erkenntnis der Motive in seine Charakterlehre ein.
- [30] Als Stellvertreter der unbelebten Natur.
- [31] Um das Motiv bei Tieren geht es in der Darstellung der Probevorlesung Schopenhauers in Berlin 1820, in welcher nach Hübscher (1945:23) Hegel dem jungen Arthur Schopenhauer eine Falle stellen wollte und dabei eine schmachvolle Niederlage erlitt als ein anwesender Mediziner dem „jungen Herausforderer“ Recht gibt. Diese Darstellung ist allerdings nicht korrekt, wie das Sitzungsprotokoll vermuten lässt (Koßler 1990:245).
- [32] „Atma“ ist der Begriff für Weltseele, aus der indischen Philosophie. Zu Schopenhauer und Atmas Charakter vgl. Lucia Franz, Über Schopenhauers häusliches Leben, in: 3. Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft 1914, S. 78 ff. Oder „Atman“ nach Hans Taub, Schopenhaurs Schreibtisch, in: 17. Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft 1930, S. 327 ff.
- [33] Dazu hat er auch mit seinen Schimpftiraden beigetragen: Die dänische Akademie lehnte es ab, ihn, den einzigen Einsender zu einer Preisfrage, auszuzeichnen, weil er andere deutsche Philosophen abschätzig behandelt habe. Vgl. Robert Zimmer, Leben, in: Daniel Schubbe/Matthias Koßler (Hrsg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2018, S. 17.
- [34] Vgl. Werner Stegmaier, Friedrich Nietzsche zur Einführung, Hamburg: Junius 2011, S. 118 f.
- [35] Vgl. Robert Wicks, Arthur Schopenhauer. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition). Herausgegeben von Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/schopenhauer/>.
- [36] Philipp Mainländer, Philosophie der Erlösung. Band 1, Berlin 1876, S. 52.
- [37] Vgl. ebd., S. 106.
- [38] Vgl. ebd.
- [39] Ebd., S. 107.
- [40] Vgl. Jan Kerkmann, Natur – Schopenhauer und Goethe im Dialog, noch unveröffentlicht, 2018.